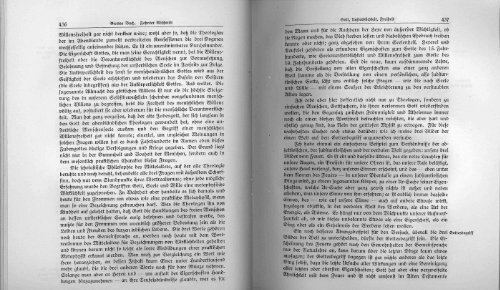Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
436 Viertes Buch. Zehnter Abschnitt<br />
Willensfreiheit gar nicht denkbar wäre; wohl aber so, daß die Theologien<br />
der im Abendlande zumeist verbreiteten Konfessionen die drei Dogmen<br />
wechselseitig aufeinander stützen. Es ist ein unentwirrbares Durcheinander.<br />
Die Eigenschaft Gottes, die man seine Gerechtigkeit nennt, hat die Willensfreiheit<br />
oder die Verantwortlichkeit des Menschen zur Voraussetzung,<br />
Belohnung und Bestrafung der unsterblichen Seele im Jenseits zur Folge.<br />
Die Unkörperlichkeit des sonst so menschenähnlichen Gottes wird aus der<br />
Geistigkeit der Seele erschlossen und wiederum das Dasein von Geistern<br />
(die Seele inbegriffen) aus der Unkörperlichkeit Gottes. Und weiter. Die<br />
sogenannte Allmacht des göttlichen Willens ist nur als die höchste Steigerung<br />
des in unserem Selbstbewußtsein scheinbar vorgefundenen menschlichen<br />
Willens zu begreifen, hebt die Freiheit des menschlichen Willens<br />
völlig auf, postuliert sie aber wiederum für die menschliche Verantwortlichkeit.<br />
Man hat ganz vergessen, daß der alte Judengott, der sich langsam in<br />
den Gott der abendländischen Theologen gewandelt hat, ohne eine unsterbliche<br />
Menschenseele auskam und den Begriff einer menschlichen<br />
Willensfreiheit gar nicht kannte; einerlei, um ungleicher Meinungen in<br />
solchen Fragen willen hat es durch Jahrhunderte im Namen eben dieses<br />
Judengottes blutige Verfolgungen und Kriege gegeben. Der Grund liegt<br />
nicht nur in der Dummheit und Bosheit der Menschen, sondern auch in<br />
dem wesentlich praktischen Charakter dieser Fragen.<br />
Die scholastische Philosophie des Mittelalters, auf der alle Theologie<br />
beruhte und noch beruht, behandelte alle drei Fragen mit äußerstem Scharfsinn,<br />
doch nur vom Standpunkte ihres Wortrealismus; ohne jede mögliche<br />
Erfahrung wurde den Begriffen Gott, Seele und Wille eine metaphysische<br />
Wirklichkeit zugesprochen. In Wahrheit aber handelte es sich damals und<br />
heute für den Frommen um etwas wie eine praktische Metaphysik, wenn<br />
man so eine Bezeichnung gebrauchen darf. Was die Theologen ihn von<br />
Kindheit auf gelehrt hatten, daß Gott die Handlungen des freien Menschen<br />
an dessen unsterblicher Seele ewig belohnen und bestrafen werde, das<br />
mußte für den Frommen von unendlich größerer Bedeutung sein als die<br />
Leiden und Freuden des kurzen irdischen Lebens. Die drei Worte gehören<br />
noch heute der Gemeinsprache an, werden noch heute mit dem Wortrealismus<br />
des Mittelalters für Bezeichnungen von Wirklichkeiten gehalten<br />
und können darum nicht so leicht als leere Einbildungen einer praktischen<br />
Metaphysik erkannt werden. Man muß zur Vergleichung ein Wort wie<br />
Hexe heranziehen, an dessen Inhalt kaum Einer unter Hunderttausend<br />
mehr glaubt, die die drei anderen Worte noch für bare Münze nehmen.<br />
Solange man aber an Hexen und — um anstatt der Eigenschaften Handlungen<br />
hinzuzunehmen — an ihre Teufelsbündnisse glaubte, war es für<br />
Gott, Unsterblichkeit, Freiheit 437<br />
den Mann und für die Nachbarn der Hexe von äußerster Wichtigkeit, ob<br />
sie Regen machen, das Vieh sterben lassen und diabolischen Ehebruch treiben<br />
konnte oder nicht; ganz abgesehen von ihrem Seelenheil. Hexerei und<br />
Teufelei gehörten als erfundene Eigenschaften zum Gotte des 15. Jahrhunderts,<br />
wie Seelenunsterblichkeit und Willensfreiheit zum Gotte des<br />
19. Jahrhunderts gehörten. Erst die neue, kaum aufdämmernde Lehre,<br />
daß die Vorstellung von allen Eigenschaften aus einer ganz anderen<br />
Welt stamme als die Vorstellung von einem persönlichen, also substantivischen<br />
Gotte, läßt uns endlich solche Fragen — wie die nach Seele<br />
und Wille — mit einem Seufzer der Erleichterung zu den verstaubten<br />
Akten legen.<br />
Ich rede aber hier hoffentlich nicht nur zu Theologen, sondern zu<br />
einfachen Menschen, Gottsuchern, die ihren verlorenen Gott wiederfinden<br />
wollen, die den Gegensatz zwischen Frömmigkeit und Atheismus immer<br />
noch als einen bloßen Wortstreit betrachten möchten, die aber hart und<br />
ehrlich genug sind, das Nein der gottlosen Mystik zu ertragen. Für diese<br />
wahrhaften Sucher noch etwas darüber: wie ich meine drei Bilder der<br />
einen Welt auf den Gottesbegriff anzuwenden versuche.<br />
Ich habe einmal ein einfacheres Beispiel zum Verständnisse der adjektivischen,<br />
der substantivischen und der verbalen Welt gegeben: unsere drei<br />
Bilder vom Feuer. Es ist ein und dasselbe Etwas, das ein rotes Leuchten für<br />
unsere Augen, ein Prasseln für unsere Ohren ist, das unsere Nase belästigt,<br />
unsere Haut versengt, kurz unseren Sinnen erscheint, und das — eben unter<br />
dem Namen des Feuers — in unserer Phantasie zu einem substantivischen<br />
Dinge wird, zu einem sogenannten Körper, zu einer Ur-Sache seiner Eigenschaften,<br />
welche Ur-Sache aber ganz gewiß nichts ist außer und neben<br />
alledem, was unsere Sinne von ihm erfahren; es ist endlich immer dasselbe<br />
Etwas, das — wie auf unsere Sinne — auch auf andere Etwase wirkt,<br />
sozusagen objektiv, in der verbalen Welt des Werdens, als eine Art der<br />
Energie, als Wärme. Es hängt nur von dem Blickpunkte unserer Aufmerksamkeit<br />
ab, ob wir dieses unbekannte Etwas als eine Eigenschaft, als ein<br />
Ding oder als ein Geheimnis des Werdens sehen wollen.<br />
Ein noch besseres Übungsbeispiel für den Versuch, überall die drei Gottesbegriff<br />
Bilder der Welt zu unterscheiden, dürfte der Gottesbegriff sein. Die Erscheinung<br />
des Feuers gehört nach den Gewohnheiten der Gemeinsprache<br />
nur der Naturlehre an, kann darum über die letzten Dinge kaum etwas<br />
aussagen; der Gottesbegriff dagegen ist gar nichts anderes als das letzte<br />
Ding selbst, dazu die letzte Ursache aller Wirkungen und eine Vereinigung<br />
aller letzten oder obersten Eigenschaften; Gott hat aber eine verzweifelte<br />
Ähnlichkeit mit dem Feuer und ist nicht umsonst im Alten Testamente