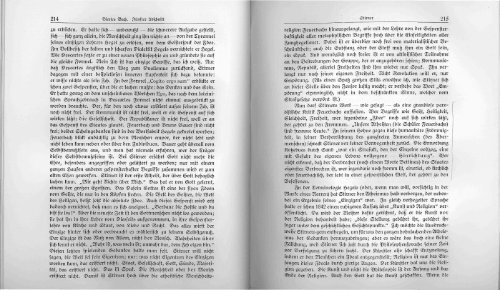Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
214 Viertes Buch. Fünfter Abschnitt<br />
zu erblicken. Er hatte sich — unbewußt — die schwerere Aufgabe gestellt,<br />
sich — sich ganz allein, die Menschheit ging ihn nichts an — von der Tyrannei<br />
seines einstigen Lehrers Hegel zu erlösen, von dem Geisterspuk der Idee.<br />
Im Vollbesitz der kalten und scharfen Dialektik Hegels vernichtete er Hegel.<br />
Wie Descartes setzte er zu einer neuen Philosophie an und gründete sie auf<br />
die gleiche Formel. Mein Ich ist das einzige Gewisse, das ich weiß. Nur<br />
daß Descartes ängstlich den Weg zum Dualismus zurückfand, Stirner<br />
dagegen mit einer beispiellosen inneren Tapferkeit sich dazu bekannte:<br />
er wisse nichts als sein Ich. In der Formel "Cogito ergo sum" erblickte er<br />
schon zwei Gespenster, über die er lachen mußte: das Denken und das Sein.<br />
Er hatte genug an dem unscheinbaren Wörtchen Ego, das nach dem lateinischen<br />
Sprachgebrauch in Descartes Formel nicht einmal ausgedrückt zu<br />
werden brauchte. Der, für den noch etwas existiert außer seinem Ich, ist<br />
noch nicht frei. Der Kommunist ist nicht frei, weil er ein Gespenst auf sich<br />
wirken läßt: die Gesellschaft. Der Republikaner ist nicht frei, weil er an<br />
das Gespenst des Staates glaubt. Feuerbach und Bruno Bauer sind nicht<br />
frei; beider Schemgedanken sind in der Wortfabrik Hegels geknetet worden;<br />
Feuerbach blickt andächtig zu dem Menschen empor, der nicht lebt und<br />
nicht leben kann neben oder über den Individuen. Bauer geht überall vom<br />
Selbstbewußtsein aus, und man hat niemals erfahren, wer der Träger<br />
dieses Selbstbewußtseins ist. Bei Stirner erfährt Gott nicht mehr die<br />
Ehre, besonders angegriffen oder gelästert zu werden; nur mit einem<br />
ganzen Haufen anderer gespensterhafter Begriffe zusammen wird er zum<br />
alten Eisen geworfen. Stirner ist der erste Atheist, der über Gott behaglich<br />
lachen kann. "Mir geht Nichts über Mich." Das hat er von Gott gelernt,<br />
einem der großen Egoisten. Das Dasein Gottes ist eine der fixen Ideen<br />
vom Geiste, die nur in den Köpfen stecken. Die Welt des Geistes, die Welt<br />
des Heiligen, heißt jetzt die absolute Idee. Auch dieses Gespenst wird erst<br />
dadurch vernichtet, daß man es sich aneignet. "Verdaue die Hostie und du<br />
bist sie los!" Aber die neueste Zeit ist den Gottmenschen nicht los geworden;<br />
sie hat ihn in ihre Lehre vom Diesseits aufgenommen, in ihre Gespensterlehre<br />
von Kirche und Staat, von Liebe und Recht. Das alles wirft der<br />
Einzige hinter sich oder verbraucht es wählerisch zu seinem Selbstgenuß.<br />
Der Einzige ist das Maß von Allem, nicht der Mensch. Wahrheiten über<br />
sich kennt er nicht. „Wahr ist, was mein ist; unwahr das, dem Ich eigen bin."<br />
Diesen letzten spielenden Gedanken halte man fest. Stirner will nicht<br />
sagen, die Welt sei sein Eigentum; nur: was nicht Eigentum des Einzigen<br />
werden kann, das existiert nicht. Staat, Gesellschaft, Gott, Sünde, Majorität,<br />
das existiert nicht. Das ist Spuk. Die Menschheit oder der Mensch<br />
existiert nicht. Damit ist Stirner hoch über die atheistische Menschheits<br />
Stirner 215<br />
religion Feuerbachs hinausgelangt, wie mit der Lehre von der Gespensterhaftigkeit<br />
aller metaphysischen Begriffe hoch über die Einseitigkeiten aller<br />
Junghegelianer. Dabei ist er überdies noch frei von materialistischer Beschränktheit;<br />
auch die Substanz oder der Stoff muß ihm ein Gott sein,<br />
ein Spuk. Und womöglich noch freier ist er von aktivistischer Teilnahme<br />
an den Bestrebungen der Gruppe, der er anzugehören schien; Kommunismus,<br />
Republik, allerlei Freiheiten sind ihm wieder nur Spuk. Ihn verlangt<br />
nur nach seiner eigenen Freiheit. Nicht Revolution will er, nur<br />
Empörung. (Als einen Spaß großen Stils erwähne ich, wie Stirner sich<br />
an dieser Stelle über den Zensor lustig macht; er verstehe das Wort "Empörung"<br />
etymologisch, nicht in dem beschränkten Sinne, welcher vom<br />
Strafgesetze verpönt ist.)<br />
Man darf Stirners Werk — wie gesagt — als eine grandiose parodistische<br />
Kritik Feuerbachs auffassen. Wer Begriffe wie Geist, Heiligkeit,<br />
Gleichheit, Freiheit, wer irgendeine „Idee" noch auf sich wirken läßt,<br />
der gehört zu den Frommen. "Unsere Atheisten (die Schüler Feuerbachs)<br />
sind fromme Leute." In seinem Hohne gegen diese humanitäre Frömmigkeit,<br />
in seiner Verherrlichung des ganzfreien Unmenschen (des Übermenschen)<br />
schreckt Stirner vor keiner Verwegenheit zurück. Die Ermordung<br />
Kotzebues durch Sand „war ein Strafakt, den der Einzelne vollzog, eine<br />
mit Gefahr des eigenen Lebens vollzogene — Hinrichtung". Wer<br />
nicht erkennt, daß der Verbrecher (nach einem Worte Bettinas) des Staates<br />
eigenstes Verbrechen ist, wer irgendwie noch fromm ist, einerlei, ob kirchlich<br />
oder feuerbachisch, der lebt in einer gespenstischen Welt, der gehört zu den<br />
Besessenen.<br />
In der Terminologie Hegels (oder, wenn man will, vorsichtig in der<br />
Maske eines Narren) hat Stirner den Atheismus halb verborgen, der nebenbei<br />
ein Ergebnis seines "Einzigen" war. In gleich verhegelter Sprache<br />
hatte er schon 1842 einen ruhigeren Aufsatz über „Kunst und Religion" veröffentlicht.<br />
Da wird der Meister dafür gerühmt, daß er die Kunst vor<br />
der Religion behandelt habe; „diese Stellung gebührt ihr, gebührt ihr<br />
sogar unter dem geschichtlichen Gesichtspunkte." Ich möchte die Ausdrucksweise<br />
Stirners gern enthegeln, um für uns den ganzen hohnlachenden Atheismus<br />
der Gedanken herauszubringen; aber es wäre das doch eine kleine<br />
Fälschung, weil Stirner sich just durch die Philosophensprache seiner Zeit<br />
vor Verfolgung zu sichern sucht. Der Künstler also schafft Entzweiung,<br />
indem er den Menschen ein Ideal entgegenstellt; Religion ist nur das Einsaugen<br />
dieses Ideals durch gierige Augen. Der Künstler hat uns die Religion<br />
gegeben. Die Kunst und nicht die Philosophie ist der Anfang und das<br />
Ende der Religion. Auch den Gott hat die Kunst geschaffen. Wenn die