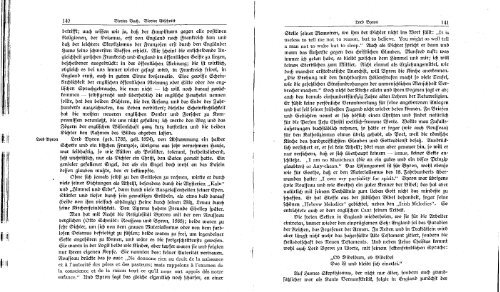Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
140 Viertes Buch. Vierter Abschnitt<br />
betrifft; auch wissen wir ja, daß der Hauptsturm gegen alle positiven<br />
Religionen, der Deismus, erst von England nach Frankreich kam und<br />
daß der leichtere Skeptizismus der Franzosen erst durch den Engländer<br />
Hume seine schwersten Waffen erhielt. Mir scheint die entscheidende Ungleichheit<br />
zwischen Frankreich und England im öffentlichen Geiste zu liegen,<br />
bescheidener ausgedrückt: in der öffentlichen Meinung; die ist wirklich,<br />
obgleich es bei uns immer wieder gesagt wird, in Frankreich frivol, in<br />
England ernst, auch in gutem Sinne konservativ. Eine gewisse Scheinkirchlichkeit<br />
der englischen öffentlichen Meinung oder Sitte oder des englischen<br />
Sprachgebrauchs, die man nicht — ich will noch darauf zurückkommen<br />
— selbstgerecht und überheblich die englische Heuchelei nennen<br />
sollte, hat den beiden Dichtern, die den Anfang und das Ende des Jahrhunderts<br />
auszeichneten, das Leben verbittert; dieselbe Scheinkirchlichkeit<br />
hat die meisten neueren englischen Denker und Forscher zu Kompromissen<br />
veranlaßt, die uns nicht gefallen; ich werde den Weg und das<br />
Zögern der englischen Wissenschaft ganz kurz darstellen und die beiden<br />
Dichter den Rahmen des Bildes abgeben lassen.<br />
Lord Byron Lord Byron (geb. 1788, gest. 1824), von Abstammung ein halber<br />
Schotte und ein bißchen Franzose, übrigens aus sehr vornehmem Hause,<br />
war leibhaftig, so wie Milton als Politiker, tolerant, freiheitsliebend,<br />
fast unchristlich, nur als Dichter ein Christ, den Satan gemalt hatte. Ein<br />
genialer gefallener Engel, der als ein Engel doch wohl an das Dasein<br />
dessen glauben mußte, den er bekämpfte.<br />
Ohne sich jemals selbst zu den Gottlosen zu rechnen, wirkte er durch<br />
viele seiner Dichtungen als Atheist, besonders durch die Mysterien „Kaïn"<br />
und „Himmel und Erde", dann durch viele Ausgelassenheiten seiner Epen.<br />
Stärker und tiefer durch sein gewaltiges Grübeln, als etwa bald darauf<br />
(beide von ihm vielfach abhängig) Heine durch seinen Witz, Lenau durch<br />
seine Kirchenfeindlichkeit. Von Byrons hohem Freunde Shelley später.<br />
Man hat mit Recht die Religiosität Byrons mit der von Rousseau<br />
verglichen (Otto Schmidt: Rousseau und Byron, 1888); beide waren zu<br />
sehr Dichter, um sich von dem grauen Materialismus oder von dem farblosen<br />
Deismus befriedigt zu fühlen; beide waren zu frei, um irgendeiner<br />
Sekte angehören zu können, und wäre es die fortgeschrittenste gewesen.<br />
Sie waren in der Logik beide wie Kinder, aber tapfer waren sie und folgten<br />
nur ihrem eigenen Kopfe. Sie nannten das: keiner Autorität vertrauen.<br />
Rousseau drückte das so aus: „Ne donnons rien au droit de 1a naissance<br />
et à l'autorité des pères et des pasteurs; mais rappelons à l'examen de<br />
la conscience et de la raison tout ce qu'il nous ont appris dès notre<br />
enfance." Und Byron sagt das gleiche eigentlich noch schärfer, an einer<br />
Lord Byron 141<br />
Stelle seiner Memoiren, wo ihm der Dichter nicht ins Wort fällt: „It is<br />
useless to tell me not to reason, but to believe. You might as well tell<br />
a man not to wake but to sleep." Auch als Dichter spricht er dann und<br />
wann das Äußerste gegen den christlichen Glauben. Manfred ruft: was<br />
immer ich getan habe, es bleibt zwischen dem Himmel und mir; ich will<br />
keinen Sterblichen zum Mittler. Nicht einmal als Erziehungsmittel, wie<br />
doch mancher aristokratische Anarchist, will Byron die Kirche anerkennen.<br />
„Die Drohung mit den furchtbarsten Höllenstrafen macht so viele Teufel,<br />
wie die gesetzlichen Strafandrohungen der unmenschlichen Menschheit Verbrecher<br />
machen." Doch nicht der Kirche allein und ihren Dogmen sagt er ab;<br />
auch den damals einhundertfünfzig Jahre alten Lehren der Naturreligion.<br />
Er fühlt keine persönliche Verantwortung für seine angeborenen Anlagen<br />
und hat seit seiner frühesten Jugend nicht wieder beten können. In Briefen<br />
und Gedichten nennt er sich höflich einen Christen und findet natürlich<br />
für die Person Jesu Christi weltlich-fromme Worte. Wollte man Zufallsäußerungen<br />
buchstäblich nehmen, so hätte er sogar (wie auch Rousseau)<br />
für den Katholizismus etwas übrig gehabt, als Poet, weil die römische<br />
Kirche den handgreiflichsten Glauben und Gottesdienst besaß. Ausdrücklich<br />
versichert er, er sei kein Atheist; hört man aber genauer hin, so will er<br />
nur versichern, daß er sich überhaupt keinem — ismus, keiner Sekte anschließe.<br />
„I am no Manichean (die an ein gutes und ein böses Prinzip<br />
glaubten) or Any-chean." Das Lösungswort ist für Byron, wohl ebenso<br />
wie für Goethe, daß er den Materialismus des 18. Jahrhunderts überwunden<br />
hatte: „I own my partiality for spirit." Byron war übrigens<br />
(wie Rousseau und wie Goethe) ein guter Kenner der Bibel; das hat aber<br />
natürlich mit seinem Verhältnis zum lieben Gott nicht das mindeste zu<br />
schaffen. Er hat Stoffe aus der jüdischen Bibel behandelt, sogar seine<br />
schönen „Hebrew Melodies" gedichtet, neben den „Irish Melodies". So<br />
entrichtete auch er dem englischen Cant seinen Tribut.<br />
Die freien Sekten in England wiederholen, wo sie für die Arbeiter<br />
eintreten, immer wieder den einprägsamen Satz: England sei das Paradies<br />
der Reichen, das Fegefeuer der Armen. In Reden und in Traktätlein wird<br />
aber längst nicht mehr das haßerfüllte Alte Testament zitiert, sondern die<br />
Heilsbotschaft des Neuen Testaments. Und neben Jesus Christus kommt<br />
wohl auch Lord Byron zu Worte, mit seinem sektenfeindlichen Spruche:<br />
„Ob Dideldum, ob Dideldei<br />
Das ist und bleibt sich einerlei."<br />
Auf Humes Skeptizismus, der nicht nur älter, sondern auch grundsätzlicher<br />
war als Kants Vernunftkritik, folgte in England zunächst der