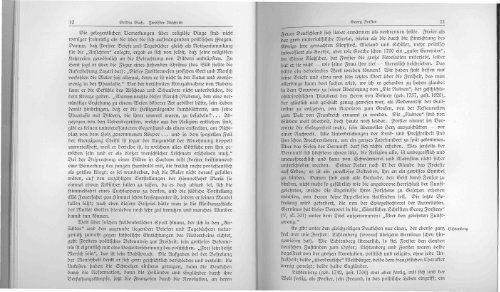Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10 Drittes Buch. Zwölfter Abschnitt<br />
Die gelegentlichen Bemerkungen über religiöse Dinge sind nicht<br />
weniger freimütig als die über die sich aufdrängenden politischen Fragen.<br />
Daraus, daß Forster Briefe und Tagebücher gleich als Notizensammlung<br />
für die "Ansichten" anlegte, ergab es sich von selbst, daß seine religiösen<br />
Ketzereien gewöhnlich an die Betrachtung von Bildern anknüpften. In<br />
Gent sagt er über die Figur eines stehenden Christus (das Bild stellte die<br />
Auferstehung Lazari dar) : "Dieses Zwitterwesen zwischen Gott und Mensch<br />
verfehlen die Maler fast allemal, denn es ist nicht in der Natur und ebensowenig<br />
in der Phantasie." Vor der berühmten Kreuzabnahme von Rubens<br />
kann er die Gefühle des Abscheus und Schauders nicht unterdrücken, die<br />
dem Kreuze gelten. "Warum mußte dieser Mensch (Rubens), den eine vernünftige<br />
Erziehung zu einem Wesen höherer Art gebildet hätte, sein Leben<br />
damit hinbringen, daß er die Heiligenlegende durchblätterte, um seine<br />
Phantasie mit Bildern, die ihrer unwert waren, zu besudeln? . . . Abgezogen<br />
von den Nebenbegriffen, welche aus der Religion entliehen sind,<br />
gibt es keinen uninteressanteren Gegenstand als einen entseelten, am Richtplatz<br />
von dem Holz genommenen Körper . . . und in dem speziellen Fall<br />
der Kreuzigung Christi ist sogar der Augenblick der Abnehmung doppelt<br />
unvorteilhaft, weil er derselbe ist, in welchem alles Göttliche von ihm gewichen<br />
sein und er als bloßer menschlicher Leichnam erscheinen muß."<br />
Bei der Besprechung eines Bildes in Sardam teilt Forster beistimmend<br />
eine Bemerkung des jungen Humboldt mit, die freilich mehr protestantisch<br />
als gottlos klingt: es sei wunderbar, daß die Maler nicht darauf gefallen<br />
wären, auf den unzähligen Vorstellungen der Himmelfahrt Maria sie<br />
einmal etwas Irdisches fallen zu lassen, da es doch absurd sei, sich die<br />
Himmelfahrt eines Tuchlappens zu denken, und die jüdische Vorstellung<br />
Eliä Feuerfahrt gen Himmel schon konsequenter ist, indem er seinen Mantel<br />
fallen läßt; nach eben diesem Beispiel hätte man ja die Kleidungsstücke<br />
der Mutter Gottes hienieden noch sehr gut benutzen und manches Wunder<br />
damit tun können.<br />
Weit über solchen freidenkerischen Spott hinaus, der sich in den "Ansichten"<br />
und den zugrunde liegenden Briefen und Tagebüchern naturgemäß<br />
zumeist gegen katholische Einrichtungen des Niederrheins richtet,<br />
geht Forsters politisches Bekenntnis zur Freiheit; sein gottloses Bekenntnis<br />
ist eigentlich nur eine Begleiterscheinung des politischen. ,,Frei sein heißt<br />
Mensch sein", das ist sein Wahlspruch. Die Aufgaben bei der Befreiung<br />
der Menschheit denkt er sich gern geschichtlich verschieden und verteilt: die<br />
Unkosten haben die Schweizer einstens getragen, dann die Deutschen<br />
durch die Reformation, dann die Holländer und Engländer durch ihre<br />
Verfassungskämpfe, jetzt die Franzosen durch die Revolution, an deren<br />
Georg Forster 1 1<br />
Feuer Deutschland sich lieber erwärmen als verbrennen sollte. Freier als<br />
der grob materialistische Nicolai, härter als die durch die Hinrichtung des<br />
Königs irre gemachten Klopstock, Wieland und Schiller, mehr politisch<br />
interessiert als Goethe, aber wie Goethe schon 1790 ein "guter Europäer",<br />
im Sinne Nietzsches, hat Forster die große Revolution miterlebt, leider<br />
hat er sie nicht — wie seine Frau ihm riet — literarisch beschrieben. Das<br />
hätte ein befreiendes Werk werden können! Wir haben statt dessen nur<br />
seine Briefe und etwa noch sein letztes Wort über die Freiheit, das man<br />
allerdings kaum dort suchen wird, wo ich es gefunden zu haben glaube:<br />
in dem Vorworte zu seiner Übersetzung von "Die Ruinen", der geschichtsphilosophischen<br />
Plauderei des Herrn von Volney (geb. 1757, gest. 1820),<br />
der glücklich und geschickt genug gewesen war, als Moderantist der Guillotine<br />
zu entgehen, von Napoleon zum Grafen, von der Restauration<br />
zum Pair von Frankreich ernannt zu werden. Die "Ruinen" sind von<br />
Gibbon weit überholt, doch heute noch lesbar. Forster nimmt im Vorworte<br />
die Gelegenheit wahr, sein übervolles Herz auszuschütten — vor<br />
einer Nachwelt. Alle Unterdrückungen der Denk- und Preßfreiheit sind<br />
ihm schon Anachronismen, um ein ganzes Jahrhundert zu spät gekommen.<br />
Über das Gesetz der Vernunft darf sich nichts erheben. Was jenseits der<br />
Vernunft sich höchstens ahnen läßt, die Religion also, ist unbegreiflich und<br />
unaussprechlich und kann von Schwärmerei und Wahnsinn nicht sicher<br />
unterschieden werden. Seiner Natur nach ist der Glaube das Freieste<br />
auf Erden; es ist ein zweckloses Bestreben, ihn an ein gewisses Symbol<br />
zu binden. Darum sind auch alle Versuche, den Geist durch Zensur zu<br />
binden, nicht mehr so gefährlich wie die angeborene Herrschlust der Zunftgelehrten,<br />
welche die Ergebnisse ihres Forschens zu Gesetzen erheben<br />
möchten, von denen keine Appellation stattfinden soll. Die letzte Befreiung<br />
wird gefordert, die von der Spiegelfechterei der Autoritäten.<br />
Gervinus hat dieses Vorwort in die "Sämtlichen Schriften Georg Forsters"<br />
(V, S. 301) unter dem Titel aufgenommen: "Über den gelehrten Zunftzwang."<br />
Es gibt unter den gleichzeitigen Deutschen nur einen, der ebenso ganz Lichtenberg<br />
frei war wie Forster: Lichtenberg (worauf übrigens Gervinus schon hingewiesen<br />
hat). Wie Lichtenberg literarisch, so fiel Forster den elenden<br />
deutschen Zuständen zum Opfer; Lichtenberg und Forster waren beide<br />
begeistert von der großen Revolution, politisch und religiös, ohne jede Unfreiheit;<br />
beide "überdeutsche" Weltbürger, beide dem französischen Charakter<br />
wenig geneigt; beide halbe Engländer.<br />
Lichtenberg (geb. 1742, gest. 1799) war aber fertig, mit sich und der<br />
Welt fertig, als Forster, sein Freund, in das politische Leben eingriff; ein