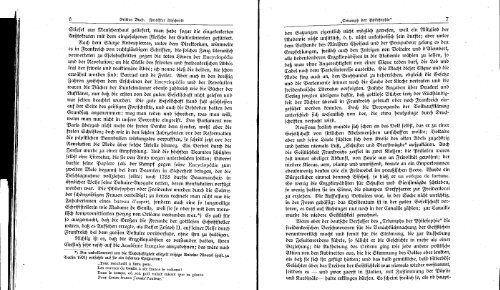Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6 Drittes Buch. Zwölfter Abschnitt<br />
Stiefel aus Menschenhaut geliefert, man habe sogar die eingekerkerten<br />
Aristokraten mit dem eingesalzenen Fleische der Guillotinierten gefüttert.<br />
Nach dem Sturze Robespierres, unter dem Direktorium, wimmelte<br />
es in Frankreich von rechtgläubigen Schriften, die solches Zeug literarisch<br />
verwerteten zu Eselshuftritten gegen die toten Löwen der Encyclopédie<br />
und der Revolution; an die Stelle des frivolen und freidenkerischen Abbés<br />
trat der frivole und reaktionäre Abbé; ich nenne bloß die beiden, die schon<br />
erwähnt worden sind: Barruel und de Feller. Aber auch in den dreißig<br />
Jahren zwischen dem Erscheinen der Encyclopédie und der Revolution<br />
waren die Bücher der Dunkelmänner ebenso zahlreich wie die Bücher der<br />
Aufklärer, nur daß die ersten von der guten Gesellschaft nicht gelesen und<br />
nur selten beachtet wurden. Die gute Gesellschaft stand fast geschlossen<br />
auf der Seite des geistigen Fortschritts, und auch die Behörden hatten den<br />
Grundsatz angenommen: mag man reden und schreiben, was man will,<br />
wenn man nur nicht in unsere Vorrechte eingreift. Das Parlament von<br />
Paris übergab nicht mehr die freien Denker dem Henker, wohl aber die<br />
freien Schriften; doch wie in den letzten lahrzehnten vor der Reformation<br />
die päpstlichen Bannbullen wirkungslos verpufften, so schritt jetzt vor der<br />
Revolution die Mode über solche Urteile hinweg. Ein Verbot durch die<br />
Zensur wurde zu einer Empfehlung. Und die höchsten Beamten schützten<br />
selbst eine Literatur, die sie von Amts wegen unterdrücken sollten; Diderot<br />
durfte seine Papiere (als der Kampf gegen seine Encyclopédie zum<br />
zweiten Male begann) bei dem Beamten in Sicherheit bringen, der die<br />
Beschlagnahme vollziehen sollte; noch 1785 durfte Beaumarchais in<br />
ähnlicher Weise seine Voltaire-Ausgabe retten, deren Konfiskation verfügt<br />
worden war. Die Philosophen oder Freidenker wurden durch die Salons<br />
der schöngeistigen Frauen verteidigt; zu denen rechnete man nicht nur die<br />
Inhaberinnen eines bureau d'esprit, sondern auch eine so langweilige<br />
Schriftstellerin wie Madame de Genlis, weil sie so oder so mit dem moralisch<br />
kompromittierten Herzog von Orléans verbunden war.*) Es galt für<br />
so ausgemacht, daß die Großen die Freunde der gottlosen Schriftsteller<br />
wären, daß es Aufsehen erregte, als Kaiser Joseph II. auf seiner Reise durch<br />
Frankreich bei dem greisen Voltaire vorüberfuhr, ohne ihm zu huldigen.<br />
Richtig ist es, daß die Enzyklopädisten es verstanden hatten, ihren<br />
Einfluß sehr rasch auf die Académie française auszudehnen; das wäre nach<br />
*) Der unbekümmert um die Wahrhaftigkeit allezeit witzige Antoine Rivarol (gest. zu<br />
Berlin 1801) verfaßte auf sie ein infames Epigramm;<br />
„Tout rencherit à faire peur.<br />
Les œuvres de Genlis à six francs le volume!<br />
Dans le temps, où son poil valait mieux que sa plume<br />
Pour douze francs j'avais l'auteur."<br />
„Triumph der Philosophie" 7<br />
den Satzungen eigentlich nicht möglich gewesen, weil ein Mitglied der<br />
Akademie nicht unsittlich, d. h. nicht unkatholisch sein durfte; aber unter<br />
dem Beistande des Ministers Choiseul und der Pompadour gelang es den<br />
Empfehlungen, freilich auch den Intrigen von Voltaire und d'Alembert,<br />
alle bedeutenderen Enzyklopädisten in die Akademie wählen zu lassen, so<br />
daß man ohne Ungerechtigkeit von einer Clique reden darf, die Lob und<br />
Tadel nach dem Parteiinteresse austeilte. Die Macht dieser Clique und die<br />
Mode fing auch an, den Buchhandel zu beherrschen, obgleich die Gesetze<br />
und die Parlamente immer noch die Sache der Kirche vertraten und die<br />
freidenkerische Literatur verfolgten. Falsche Angaben über Druckort und<br />
Verlag sorgten übrigens dafür, daß gottlose Bücher trotz der Rückständigkeit<br />
der Richter überall in Frankreich gedruckt oder nach Frankreich eingeführt<br />
werden konnten. Doch die Propaganda der Volksaufklärung<br />
unterschied sich wesentlich von der, die etwa heutzutage durch Druckschriften<br />
versucht wird.<br />
Rousseau freilich wandte sich schon an das Volk selbst, das er zu einer<br />
Gesellschaft von sittlichen Adelsmenschen umschaffen wollte; Voltaire<br />
aber und seine Leute fühlten sich dem Kreise des alten Adels zugehörig<br />
und hatten niemals Lust, „Schuster und Dienstmägde" aufzuklären. Auch<br />
die Geistlichkeit Frankreichs zerfiel in zwei Klassen: die Prälaten waren<br />
fast immer adeliger Abkunft, von Hause aus an Frivolität gewöhnt; der<br />
niedere Klerus, arm, plump und unwissend, konnte an ein Emporkommen<br />
ebensowenig denken wie ein Feldwebel im preußischen Heere. Wurde ein<br />
Bürgerlicher einmal dennoch Bischof, so hieß er un evêque de fortune.<br />
So wenig die Enzyklopädisten für Schuster und Dienstmägde schrieben,<br />
so wenig hatten sie im Sinne, die plumpen Dorfpfarrer zur Freidenkerei<br />
zu erziehen. Die Auffassung Voltaires war, in der Sache nicht unrichtig,<br />
in der Form gehässig: das Christentum ist in der guten Gesellschaft verloren,<br />
es darf auf Anhänger nur noch in der Canaille zählen; zur Canaille<br />
wurde die niedere Geistlichkeit gerechnet.<br />
Wenn aber der deutsche Verfasser des "Triumphs der Philosophie" die<br />
freidenkerischen Verschworenen für die Verächtlichmachung der Geistlichen<br />
verantwortlich macht und somit für die Strömung, die zur Aufhebung<br />
des Jesuitenordens führte, so fälscht er die Geschichte in mehr als einer<br />
Beziehung; die Aufhebung des Ordens ging wie jede andere politische<br />
Aktion von den Kabinetten aus, die die Stimmung des Volkes eher lenkten,<br />
als daß sie sich ihr gefügt hätten; und das bald gemütliche, bald bitterböse<br />
Gelächter über das Treiben der Geistlichkeit war niemals wieder verstummt,<br />
seitdem es — und zwar zuerst in Italien, mit Zustimmung der Päpste<br />
und Kardinäle— hatte erklingen dürfen. Es scheint freilich so, als ob haupt