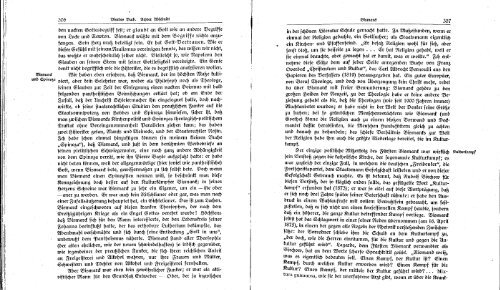Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
306 Viertes Buch. Achter Abschnitt<br />
den nackten Gottesbegriff fest; er glaubt an Gott wie an andere Begriffe<br />
von Locke und Newton. Bismarck wüßte mit dem Begriffe nichts anzufangen.<br />
Sein Herz muß beteiligt sein. Er hat Gott-Vertrauen. Wie er<br />
dieses Gefühl mit seinem Realismus vereinigen konnte, das wissen wir nicht,<br />
das wußte er wahrscheinlich selber nicht. Vielleicht so, wie Napoleon den<br />
Glauben an seinen Stern mit seiner Gottlosigkeit vereinigte. Ein Genie<br />
denkt nicht begrifflich wie die Historiker, die es begrifflich analysieren wollen.<br />
Bismarck Wir haben eben erfahren, daß Bismarck, der im höchsten Maße kultiviert,<br />
aber kein Gelehrter war, weder als Philosoph noch als Theologe,<br />
seinen Glauben zur Zeit der Einsegnung einen nackten Deismus mit bald<br />
folgenden pantheistischen Beimischungen erklärt hat; ob am Ende der<br />
Zufall, daß der Unchrist Schleiermacher ihn eingesegnet hatte, doch nachwirkte,<br />
ob seine staatsrechtlichen Studien den preußischen Junker auf die<br />
Staatsomnipotenz von Hobbes und Spinoza hinwiesen, sicher ist, daß<br />
man zwischen Bismarcks Kirchenpolitik und Spinozas theologisch-politischem<br />
Traktat ohne Voreingenommenheit Parallelen ziehen kann; das haben<br />
zwei Historiker getan, Marcks und Meinecke, und der Staatsrechtler Rosin.<br />
Ich habe schon einmal hinzufügen können (in meinem kleinen Buche<br />
"Spinoza"), daß Bismarck, und just in dem berühmten Werbebriefe an<br />
seinen pietistischen Schwiegervater, eine noch ganz andere Abhängigkeit<br />
von dem Spinoza verrät, wie ihn Pierre Bayle aufgefaßt hatte: er habe<br />
nicht beten können, weil der allgegenwärtige (hier soviel wie pantheistische)<br />
Gott, wenn Bismarck bete, gewissermaßen zu sich selbst bete. Doch wenn<br />
man Bismarck einen Spinozisten nennen will, so beschränkt man diese<br />
Kennzeichnung doch besser auf den Kulturkämpfer Bismarck; in seines<br />
Herzens Schreine war Bismarck zu sehr ein Eigener, um ein — iste oder<br />
—aner zu werden. Er war auch kein Ritschlianer oder gar, was man nach<br />
einer Zufallsäußerung behauptet hat, ein Gichtelianer. Das ist zum Lachen.<br />
Bismarck eingeschworen auf diesen kranken Theosophen, der nach dem<br />
Dreißigjährigen Kriege als ein Engel Gottes verehrt wurde! Höchstens<br />
daß Bismarck sich für den Mann interessierte, der den Lebenskreis seiner<br />
Johanna beeinflußt hatte, der das orthodoxe Luthertum bekämpfte, das<br />
Abendmahl verschmähte und sich durch seine Entdeckung "Gott in uns",<br />
unbewußt dem Pantheismus näherte. Bismarck stand aller Theosophie<br />
(der alten ehrlichen, wie der neuen schwindelhaften) so irdisch gegenüber,<br />
wie irgendeiner der preußischen Junker, die sich ihren reichlichen Anteil<br />
an Freigeisterei und Alkohol wahren, nur ihre Frauen und Mütter,<br />
Schwestern und Töchter von Alkohol und Freigeisterei fernhalten.<br />
Aber Bismarck war eben kein gewöhnlicher Junker; er war als aktivistischer<br />
Mann für den Grundsatz Entweder — Oder, der ja inzwischen<br />
Bismarck 307<br />
in der schönen Literatur Schule gemacht hatte. In Mußestunden, wenn er<br />
einmal der Religion gedachte, ein Gottsucher; als Staatsmann eigentlich<br />
ein Kirchen- und Pfaffenfeind. "Er besaß Religion wohl für sich, aber<br />
sonst bloß, um sie beiseite zu legen ... Er hat Religion gehabt, weil er<br />
sie einmal brauchte, aber gemacht hat er damit, was er wollte." Ich entnehme<br />
diese Sätze dem auf jeder Seite anregenden Buche von Franz<br />
Overbeck "Christentum und Kultur", das Carl Albrecht Bernoulli aus den<br />
Papieren des Verfassers (1919) herausgegeben hat. Ein guter Europäer,<br />
von Beruf Theologe, und doch von Überzeugung kein Christ mehr, redet<br />
da über Bismarck mit freier Bewunderung: Bismarck gehöre zu den<br />
großen Heiden der Neuzeit, zu der Theologie habe er keine andere Beziehung<br />
gehabt als die, daß die Theologen (wie seit 1900 Jahren immer)<br />
Machtanbeter wurden; er habe nicht in der Welt der Denker seine Größe<br />
zu suchen; bei so gründlichen Menschenverächtern wie Bismarck (und<br />
Goethe) könne die Religion auch zu einem bloßen Vorwand und Deckmantel<br />
dafür herabsinken, die Menschen Hundsföttern gleich zu achten<br />
und danach zu behandeln; das schiefe Verhältnis Bismarcks zur Welt<br />
der Religion habe ihm auch die größte Niederlage bereitet, die im Kulturkampf.<br />
Der einzige politische Mißerfolg des Fürsten Bismarck war wirklich Kulturkampf<br />
sein Vorstoß gegen die katholische Kirche, der sogenannte Kulturkampf; es<br />
war zugleich der einzige Fall, in welchem die deutschen "Freidenker", die<br />
Fortschrittspartei, dem Staatsmann Gefolgschaft leisteten und er von dieser<br />
Gefolgschaft Gebrauch machte. Es ist bekannt, daß Rudolf Virchow für<br />
diesen Vorstoß, der so kläglich enden sollte, das geflügelte Wort "Kulturkampf"<br />
erfunden hat (1873); er war so eitel auf diese Wortprägung, daß<br />
er sich noch drei Jahre später seiner Vaterschaft rühmte: er habe den Ausdruck<br />
in einem Wahlaufrufe mit vollem Bewußtsein gebraucht, um festzustellen,<br />
daß es sich nicht um einen konfessionellen Kampf handle, sondern<br />
daß ein höherer, die ganze Kultur betreffender Kampf vorliege. Bismarck<br />
selbst hat das Schlagwort in einer seiner Reden übernommen (am 16. April<br />
1875), in einem der gegen alle Regeln der Rhetorik verstoßenden Zwischensätze:<br />
der Vorredner schiebe ihm die Schuld an dem Kulturkampf zu,<br />
„der doch, wie die Herren einräumen, für die Kultur und gegen die Unkultur<br />
geführt wird". Lagarde, dem Fürsten Bismarck verwandter als<br />
Virchow, hat an dem Worte scharfe Sprachkritik geübt. "Niemand weiß,<br />
was es eigentlich bedeuten soll. Einen Kampf, der Kultur ist? Einen<br />
Kampf, durch welchen Kultur erworben wird? Einen Kampf für die<br />
Kultur? Einen Kampf, der mittels der Kultur geführt wird? . . . Mixtura<br />
gummosa, wie sie der unerfahrene Arzt gibt, wenn er über die Krank