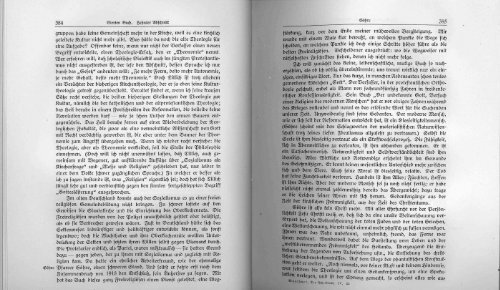Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
384 Viertes Buch. Zehnter Abschnitt<br />
gruppen habe keine Gemeinschaft mehr in der Kirche, weil es eine kirchlich<br />
geleitete Kultur nicht mehr gibt. Was hätte da noch die alte Theologie für<br />
eine Aufgabe? Offenbar keine, wenn nur nicht der Verfasser einen neuen<br />
Begriff entwickelte, einen Theologie-Ersatz, den er „Theonomie" nennt.<br />
Wer erfahren will, daß scholastische Dialektik auch im jüngsten Protestantismus<br />
nicht ausgestorben ist, der lese den Abschnitt, dessen Sprache ich nur<br />
durch das "Gesetz" andeuten will: "Je mehr Form, desto mehr Autonomie,<br />
je mehr Gehalt, desto mehr Theonomie." Doch Tillich ist trotz alledem<br />
ein Verächter der bisherigen Kirchentheologie, der er ja eben seine Kulturtheologie<br />
getrost gegenüberstellt. Veraltet findet er, wenn ich seine krausen<br />
Sätze recht verstehe, die beiden bisherigen Stellungen der Theologie zur<br />
Kultur, nämlich die der katholischen und der altprotestantischen Theologie;<br />
das Heil beruhe in einem Fortschreiten der Reformation, die beileibe keine<br />
Revolution werden darf — wie ja schon Luther den armen Bauern entgegenschrie.<br />
Das Heil beruhe ferner auf einer Wiederbelebung der theologischen<br />
Fakultät, die zwar als eine vermeintliche Wissenschaft von Gott<br />
mit Recht verdächtig geworden ist, die aber unter dem Banner der Theonomie<br />
zum Angriff übergehen muß. Wenn ich wieder recht verstehe: die<br />
Theologie, aber als Theonomie verkleidet, soll die Stelle der Philosophie<br />
einnehmen. (Doch will ich nicht unerwähnt lassen, daß Tillich, auch gemeinsam<br />
mit Wegener, gut aufklärende Aufsätze über "Sozialismus als<br />
Kirchenfrage" und „Masse und Religion" geschrieben hat, nur leider in<br />
einer dem Volke schwer zugänglichen Sprache.) In welcher er besser als<br />
ich zu sagen imstande ist, was „Religion" eigentlich sei; doch hat sich Tillich<br />
jüngst sehr gut und verdienstlich gegen den sinnlos fortgeschleppten Begriff<br />
„Gotteslästerung" ausgesprochen.<br />
Im alten Deutschland konnte auch der Sozialismus es zu einer freien<br />
religiösen Gemeindebildung nicht bringen. Zu schwer lastete auf den<br />
Gewissen die Staatskirche und die Einrichtung des Oberkirchenrats. Die<br />
Freireligiösen wurden von der Polizei unaufhörlich gestört oder belästigt,<br />
als ob sie Verbrecher gewesen wären. Just in Deutschland hätte sich das<br />
Sektenwesen inbrünstiger und heilkräftiger entwickeln können, als sonst<br />
irgendwo; doch die Machthaber und ihre Oberkirchenräte wollten Unterdrückung<br />
der Sekten und setzten ihren Willen selbst gegen Bismarck durch.<br />
Die Proletarier endlich, als Partei, waren mißtrauisch — sie hatten Grund<br />
dazu — gegen jeden, der zu ihnen mit Sozialismus und zugleich mit Religion<br />
kam. Da hatte ein ehrlicher Arbeiterfreund, wie der ehemalige<br />
Göhre Pfarrer Göhre, einen schweren Stand. Und selbst er faßte erst nach dem<br />
Zusammenbruch von 1918 den Entschluß, sein Äußerstes zu sagen. Mir<br />
hat das Buch dieses ganz Freireligiösen einen Dienst geleistet, eine Weg<br />
Göhre 385<br />
stärkung, kurz vor dem Ende meiner mühevollen Bergsteigung. Mir<br />
wurde mit einem Male klar bewußt, an welchem Punkte die Wege sich<br />
scheiden, an welchem Punkte ich doch einige Schritte höher führe als die<br />
besten Freireligiösen. Bescheidener ausgedrückt: wo die Wegweiser mit<br />
rätselhaften Inschriften stehen, denen ich nicht mehr folge.<br />
Ich will zunächst das kleine, leidenschaftliche, mutige Buch so nacherzählen,<br />
als ob ich völlig übereinstimmte; uns trennt wirklich nur ein einziges,<br />
einsilbiges Wort. Nur das kurze, in manchen Redensarten schon tonlos<br />
gewordene Wörtchen „Gott". Der Verfasser, in der protestantischen Orthodoxie<br />
geschult, endet als Mann von sechsundfünfzig Jahren in freidenkerischer<br />
Konfessionslosigkeit. Sein Buch "Der unbekannte Gott, Versuch<br />
einer Religion des modernen Menschen" hat er vor einigen Jahren während<br />
des Krieges vollendet und nennt es das erlösende Wort für die Suchenden<br />
unserer Zeit. Unzweideutig sind seine Gedanken. Der moderne Mensch,<br />
wie er sich seit der Reformation entwickelt hat, ist ein Diesseitigkeitsmensch.<br />
(Göhre scheint mir den Schlagworten der materialistischen Naturwissenschaft<br />
trotz seines tiefen Idealismus allzusehr zu vertrauen.) Selbst die<br />
Seele ist ihm diesseitig vertraut als ein Stoffwechselprozeß. Die Fähigkeit,<br />
sich in Überweltliches zu versenken, ist ihm abhanden gekommen. Er ist<br />
ein Tatsachenmensch. Notwendigkeit und Selbstverständlichkeit sind ihm<br />
identisch. Alles Wirkliche und Notwendige erscheint ihm im Gewande<br />
des Gesetzmäßigem Er kennt keinen wesentlichen Unterschied mehr zwischen<br />
sich und dem Tiere. Auch seine Moral ist diesseitig, relativ. Der Tod<br />
hat seine Furchtbarkeit verloren. Handeln ist ihm Alles; Fürchten, Hoffen<br />
ist ihm Nichts. Aber der moderne Mensch sei ja noch nicht fertig; er habe<br />
vielleicht nicht einmal zahlenmäßig bereits das Übergewicht; dazu trage<br />
er die Leichen seiner Ahnen mit sich herum. Gedankengänge aus der<br />
Zeit der kirchlichen Frömmigkeit, aus der Zeit des Christentums.<br />
Göhre ist also kein Christ mehr. Mit aller Ehrfurcht vor der Persönlichkeit<br />
Jesu Christi weiß e r , daß sich da e i n e u r a l t e Weltanschauung ver<br />
körpert hat, die Weltanschauung der toten Juden und der toten Griechen,<br />
eine Weltanschauung, die wir nicht einmal mehr physisch zu fassen vermögen.<br />
Ihnen war das Nahe unbekannt, unheimlich, fremd, das Ferne war<br />
ihnen vertraut. Wundervoll dabei die D a r s t e l l u n g vom Leben und der<br />
"weltüberrennenden Frömmigkeit" des Heilands. Überzeugend die Entstehung<br />
der Legenden von Auferstehung usw., die Entstehung des christlichen<br />
Glaubensbekenntnisses. Auf dem Wege der phantastischen Konstruk<br />
war<br />
seitdem die Theologie um einen Gedankensprung, um eine Spekulation<br />
verlegen, und ist der Sprung gemacht, so erscheint alles wie aus