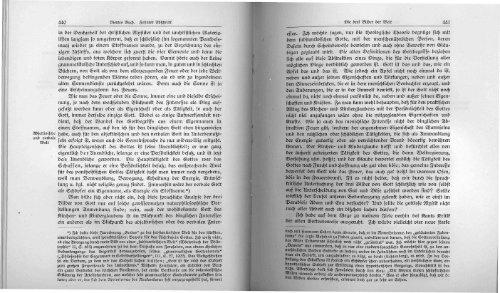Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
440 Viertes Buch. Zehnter Abschnitt<br />
in der Denkarbeit der christlichen Mystiker und der unchristlichen Materialisten<br />
langsam so umgeformt, daß er schließlich (im sogenannten Pantheismus)<br />
wieder zu einem Stoffnamen wurde, zu der Bezeichnung des einzigen<br />
Urstoffs, aus welchem sich zuerst die vier Elemente und dann die<br />
lebendigen und toten Körper geformt haben. Damit hörte auch der kleine<br />
grammatikalische Unterschied auf, und so kann man, in guten und in schlechten<br />
Büchern, von Gott als von dem allerzeugenden Feuer oder der jede Weltbewegung<br />
bedingenden Wärme reden hören, als ob wir zu irgendeinem<br />
alten Sonnendienste zurückgekehrt wären. Denn auch die Sonne ist ja<br />
eine Erscheinungsform des Feuers.<br />
Wie nun das Feuer oder die Sonne, immer eine und dieselbe Erscheinung,<br />
je nach dem wechselnden Blickpunkt des Interesses als Ding aufgefaßt<br />
werden kann oder als Eigenschaft oder als Tätigkeit, so auch der<br />
Gott, immer derselbe einzige Gott. Wobei es einige Aufmerksamkeit verdient,<br />
daß der Wandel des Gottbegriffs aus einem Eigennamen in<br />
einen Stoffnamen, auf den ich für den dinglichen Gott eben hingewiesen<br />
habe, auch für den adjektivischen und den verbalen Gott im Unterbewußtsein<br />
erfolgt ist, wenn auch die Gemeinsprache da nur widerwillig mitgeht.<br />
Die Haupteigenschaft des Gottes ist seine Unendlichkeit; er war ganz<br />
eigentlich der Unendliche, solange er eine Persönlichkeit besaß, und ist jetzt<br />
das Unendliche geworden. Die Haupttätigkeit des Gottes war das<br />
Schaffen, solange er eine Persönlichkeit besaß; das entsprechende Wort<br />
für des pantheistischen Gottes Tätigkeit sucht man immer noch vergebens,<br />
weil man Verwandlung, Bewegung, Erhaltung der Energie, Entwicklung<br />
u. dgl. nicht religiös genug findet. Immerhin wäre der verbale Gott<br />
als Schöpfer ein Eigenname, als Energie ein Stoffname.*)<br />
Man bilde sich aber nicht ein, daß diese sprachliche Analyse der drei<br />
Bilder von Gott nur auf solche gewissermaßen naturphilosophische Vorstellungen<br />
Anwendung finde; nein, auch der wohlbekannte Gott des<br />
Kirchen- und Kinderglaubens ist im Blickpunkt des dinglichen Interesses<br />
ein anderer als im Blickpunkt des adjektivischen oder des verbalen Inter<br />
*) Ich halte diese Zurechnung "Gottes" zu der substantivischen Welt für den stärksten,<br />
unwiderleglichsten, weil sprachkritischen Beweis für das Nichtdasein Gottes. Ich weiß nicht,<br />
ob eine Anregung durch mein Bild von einer "substantivischen Welt" (Wörterbuch der Philosophie"<br />
II, S. 464) anzunehmen sei bei dem Versuche von Jerusalem, aus einem ähnlichen<br />
Gedankengange das Gegenteil herauszuholen, seinen "grammatischen Gottesbeweis"<br />
("Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen", III, S. 27, 1922). Das Weltgeschehen<br />
sei ein Verbum, zu dem wir das Subjekt suchen müssen: "Gott ist für mich das Subjekt<br />
zum großen Impersonale des Universums." Wilhelm Jerusalem, als Schüler von Mach<br />
ein guter Vertreter des kritischen Realismus, hat ernste Verdienste um die voluntaristische<br />
Erklärung der Urteilsfunktion, aus welcher sein grammatischer Gottesbeweis geflossen sein<br />
kann; aber er, der sich dem Apriorismus der Neukantianer fest entgegengestellt hat, stimmt<br />
Die drei Bilder der Welt 441<br />
esses. Ich möchte sagen, nur die theologische Theorie begnüge sich mit<br />
dem substantivischen Gotte, mit der menschenähnlichen Person, deren<br />
Dasein durch Scheinbeweise bewiesen und auch ohne Beweise von Gläubigen<br />
geglaubt wird. Die alten Definitionen des Gottbegriffs beziehen<br />
sich alle auf diese Abstraktion eines Dings, die für die Vorstellung aller<br />
möglichen Dinge vorbildlich geworden ist. Gott ist das und das, wie ein<br />
Apfel das und das ist. Wie jedoch ein Apfel nicht noch einmal da ist,<br />
neben und außer seinen Eigenschaften und Wirkungen, neben und außer<br />
den Sinneseindrücken, die er in dem menschlichen Beobachter erzeugt, und<br />
den Änderungen, die er in der Umwelt bewirkt, so ist der Gott nicht noch<br />
einmal da, nicht noch einmal persönlich da, neben und außer seinen Eigenschaften<br />
und Kräften. Ja man kann wohl behaupten, daß für den praktischen<br />
Alltag des Kirchen- und Kinderglaubens mit der Persönlichkeit des Gottes<br />
nicht viel anzufangen wäre ohne die mitgeglaubten Eigenschaften und<br />
Kräfte. Wie ja auch das menschliche Interesse nicht der dinglichen Abstraktion<br />
Feuer gilt, sondern der angenehmen Eigenschaft des Warmseins<br />
und den nützlichen oder schädlichen Tätigkeiten, die sich als Umwandlung<br />
der Energie gutartig oder als vernichtender Brand bösartig bewähren<br />
können. Der Kirchen- und Kinderglaube hofft und befürchtet alles von<br />
der äußerst gesteigerten Tätigkeit des Gottes, die dann Weltregierung,<br />
Vorsehung usw. heißt; und der Glaube bewertet endlich die Tätigkeit des<br />
Gottes nach Furcht und Hoffnung als gut oder böse; das gemeine Interesse<br />
bewertet den Gott wie das Feuer, das auch gut heißt im warmen Ofen,<br />
böse in der Feuersbrunst. Ist es nicht heiter, daß wir durch die sprachkritische<br />
Untersuchung der drei Bilder von Gott schließlich wie von selbst<br />
auf die Unterscheidung von Gut und Böse geführt worden sind? Sollte<br />
wirklich der Teufel unseren Gedankengang gelenkt haben, wie er einst im<br />
Paradiese Adam und Eva versuchte? Und sollte die gottlose Mystik nicht<br />
nach aller Arbeit auch ein bißchen lachen dürfen?<br />
Ich habe auf dem Wege zu meinem Ziele vorhin bei Kants Kritik<br />
der alten Gottesbeweise ausgeruht. Ich würde vielleicht vier neue starke<br />
doch mit Hermann Cohen darin überein, daß er im Monotheismus des "geläuterten Judentums"<br />
die letzte Wahrheit zu finden glaubt, unbekümmert darum, daß die Gottesvorstellung<br />
des Alten Testaments sicherlich noch nicht "geläutert" war. Ich möchte hier gegen seinen<br />
"Beweis" nur einwenden, daß es nur eine modern-sprachliche Gewohnheit ist, zu den unpersönlichen<br />
Verben Subjekte zu suchen; weder im Hebräischen noch im Lateinischen braucht<br />
man ein Subjekt, um auszudrücken: es blitzt, es denkt (Lichtenberg), es wird. In der Vorstellung<br />
des Schaffens ist freilich ein Schöpfer schon mitenthalten, ein persönlicher Gott, ein<br />
hypothetisches Subjekt zur Erklärung eines hypothetischen Vorgangs. Sprachkritik ist das<br />
nicht. Allerdings deckt sich Jerusalem durch den Satz: "Wir können diesen schöpferischen<br />
Willen niemals anders als anthropomorphisch denken." Was er aber hinzufügt, daß wir da<br />
den Willen Gottes erforschen, erinnert doch gar zu sehr an Cohen.