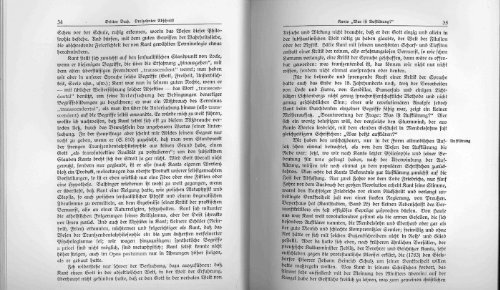Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
34 Drittes Buch. Dreizehnter Abschnitt<br />
Scheu vor der Schule, ruhig erkennen, worin das Wesen dieser Philosophie<br />
bestehe. Und dürfen, mit dem guten Gewissen der Wahrheitsliebe,<br />
die abschreckende Feierlichkeit der von Kant gewählten Terminologie etwas<br />
herabmindern.<br />
Kant stellt sich zunächst auf den sensualistischen Standpunkt von Locke,<br />
wenn er diejenigen Begriffe, die über die Erfahrung "hinausgehen", mit<br />
dem alten überflüssigen Fremdwort "transscendent" nennt; nun haben<br />
wir aber in unserer Sprache solche Begriffe (Gott, Freiheit, Unsterblichkeit,<br />
Seele usw., usw.); Kant war nun in seinem guten Rechte, wenn er<br />
— mit üblicher Weiterführung solcher Adjektive — das Wort „transscendental"<br />
benützt, um seine Untersuchung der Bedingungen derartiger<br />
Begriffsbildungen zu bezeichnen; es war ein Mißbrauch des Terminus<br />
"transscendental", als man ihn über die Untersuchung hinaus (also transscendent)<br />
auf die Begriffe selbst anwandte. Es würde mich zu weit führen,<br />
wollte ich nachweisen, daß Kant selbst sich oft zu diesem Mißbrauche verlocken<br />
ließ, durch das Bewußtsein des ungeheuern Wertes seiner Untersuchung.<br />
In der Hauptfrage aber scheint mir Adickes seinem Gegner nur<br />
recht zu geben, wenn er (S. 810) zugesteht, daß man vom Standpunkt<br />
der strengen Transzendentalphilosophie aus keinen Grund habe, einen<br />
Gott "als transsubjektive Realität zu postulieren"; um den subjektiven<br />
Glauben Kants dreht sich der Streit ja gar nicht. Wird Gott überall nicht<br />
gewußt, sondern nur geglaubt, ist er also (nach Kants eigenen Worten)<br />
bloß ein Produkt, meinetwegen das oberste Produkt unserer selbstgemachten<br />
Vorstellungen, so ist er eben wirklich nur eine Idee oder eine Fiktion oder<br />
eine Hypothese. Vaihinger wiederum ist wohl zu weit gegangen, wenn<br />
er übersieht, daß Kant eine Neigung hatte, wie zwischen Metaphysik und<br />
Skepsis, so auch zwischen sensualistischer Physik und einem dogmatischen<br />
Idealismus zu vermitteln, an dem Ergebnisse seiner Kritik der praktischen<br />
Vernunft, also an einer Naturreligion, festzuhalten. Kant sah mitunter<br />
die atheistischen Folgerungen seines Kritizismus, aber der Deist schreckte<br />
vor ihnen zurück. Und auch der Mystiker in Kant; kleinere Schüler (Reinhold,<br />
Fries) erkannten, nüchterner und folgerichtiger als Kant, daß das<br />
Wesen der Transzendentalphilosophie ein bis zum äußersten verfeinerter<br />
Psychologismus sei; wir wagen hinzuzufügen: synthetische Begriffe<br />
a priori sind nicht möglich, sind metaphysisch; Kant selbst konnte nicht<br />
höher steigen, auch im Opus postumum nur in Ahnungen höher steigen,<br />
als er gebaut hatte.<br />
Ich widerstehe nur schwer der Versuchung, dazu auszuführen: daß<br />
Kant einen Gott in der adjektivischen Welt, in der Welt der Erfahrung,<br />
überhaupt nicht gefunden hatte, daß er den Gott in der verbalen Welt von<br />
Kants „Was ist Aufklärung?" 35<br />
Ursache und Wirkung nicht brauchte, daß er den Gott einzig und allein in<br />
der substantivischen Welt nötig zu haben glaubte, der Welt der Illusion<br />
oder der Mystik. Hätte Kant mit seinem unerhörten Scharf- und Tiefsinn<br />
anstatt einer Kritik der reinen, also erfahrungslosen Vernunft, so wie schon<br />
Hamann verlangte, eine Kritik der Sprache geschaffen, dann wäre es offenbar<br />
geworden: was transzentendal ist, das können wir nicht nur nicht<br />
wissen, sondern nicht einmal aussprechen oder denken.<br />
Für die bohrende und sprengende Kraft einer Kritik der Sprache<br />
hatte auch das Ende des 18. Jahrhunderts noch, trotz der Vorarbeiten<br />
von Locke und Hume, von Condillac, Dumarsais und einigen Lichtblitzen<br />
Lichtenbergs nicht genug sprachwissenschaftliche Methode und nicht<br />
genug geschichtlichen Sinn; einer wie revolutionären Analyse jedoch<br />
Kant beim Durchdenken einzelner Begriffe fähig war, zeigt ein kleiner<br />
Meisteraufsatz. „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?" Wer<br />
sich ein wenig belustigen will, der vergleiche den Sturmwind, der aus<br />
Kants Worten losbricht, mit dem elenden Gesäusel in Mendelssohns fast<br />
gleichzeitigem Schriftchen: „Was heißt aufklären?"<br />
Wir haben den unschätzbaren, nur in der Form altmodischen Auf Aufklärung<br />
satz schon einmal betrachtet, als von dem Wesen der Aufklärung die<br />
Rede war; jetzt, wo wir nach Kants letzter Philosophie und seiner Bedeutung<br />
für uns gefragt haben, nach der Überwindung der Aufklärung,<br />
müssen wir noch einmal zu dem populären Schriftchen zurückkehren.<br />
Man achte bei Kants Bekenntnis zur Aufklärung zunächst auf die<br />
Zeit der Abfassung. Nur zwei Jahre vor dem Tode Friedrichs, nur fünf<br />
Jahre vor dem Ausbruch der großen Revolution erhebt Kant seine Stimme,<br />
warnt den Nachfolger Friedrichs vor einem Rückschritt und verlangt unbedingte<br />
Denkfreiheit just von einer starken Regierung, von Preußen.<br />
Beyerhaus hat (Kantstudien, <strong>Band</strong> 26) der kleinen Nebenschrift des Vernunftkritikers<br />
ein fast offiziöses Gepräge zusprechen dürfen. Von Hause<br />
aus war Kant weit revolutionärer gesinnt als die armen Gesellen, die sich<br />
besonders Aufklärer nannten, die Mendelssohn und Eberhard oder gar als<br />
der gute Mensch und schlechte Kompromißler Semler; freiwillig und ohne<br />
Not hätte er sich mit solchen Dutzendschreibern nicht in Reih' und Glied<br />
gestellt. Aber da hatte sich eben, nach früheren ähnlichen Vorfällen, der<br />
preußische Kultusminister Zedlitz, der Verehrer und Beschützer Kants, sehr<br />
entschieden gegen die protestantische Klerisei erklärt, die (1783) den Gielsdorfer<br />
Pfarrer Johann Heinrich Schulz um seiner Denkfreiheit willen<br />
hatte maßregeln wollen. Was Kant in seinem Schriftchen fordert, das<br />
stimmt sehr auffallend mit der Meinung des Ministers überein: auf der<br />
Kanzel habe der Geistliche freilich zu lehren, was zum gemeinen christlichen