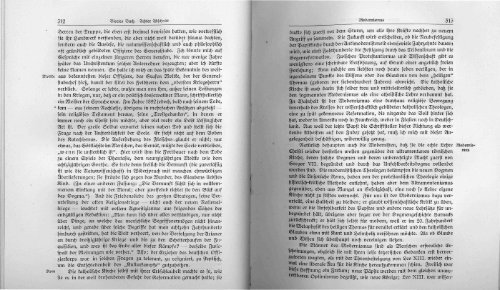Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
312 Viertes Buch. Achter Abschnitt<br />
Herren der Truppe, die eben erst dreimal bewiesen hatten, wie vortrefflich<br />
sie ihr Handwerk verstanden, die aber nicht weit darüber hinaus dachten,<br />
sondern auch die Auslese, die naturwissenschaftlich und auch philosophisch<br />
oft gründlich gebildeten Offiziere des Generalstabs. Ich könnte mich auf<br />
Gespräche mit einzelnen jüngeren Herren berufen, die nur wenige Jahre<br />
später das Unchristentum solcher Unterredner bezeugten; aber ich dürfte<br />
keine Namen nennen. So halte ich mich an das späte Bekenntnis des weitaus<br />
bekanntesten dieser Offiziere, des Grafen Moltke, der der Generalstabschef<br />
hieß, damit der Titel des Feldherrn dem "obersten Kriegsherrn"<br />
verblieb. Solange er lebte, wußte man von ihm, außer seinen Leistungen<br />
in den Kriegen, nur, daß er ein politisch konservativer Mann, schriftstellerisch<br />
ein Meister der Sprache war. Im Jahre 1892 jedoch, bald nach seinem Tode,<br />
kam — aus seinem Nachlasse, übrigens in mehrfachen Ansätzen abgefaßt —<br />
sein religiöses Testament heraus, seine "Trostgedanken", in denen er<br />
immer noch ein Christ sein möchte, aber viel mehr ein Deist Lessingscher<br />
Art ist. Der greise Soldat erwartet seinen nahen Tod und stellt sich die<br />
Frage nach der Unsterblichkeit der Seele. Er steht nicht auf dem Boden<br />
des Katechismus. Die Auferstehung des Fleisches glaubt er nicht; nur<br />
etwas, das Göttlichste im Menschen, das Gemüt, müßte der Seele verbleiben,<br />
„wenn sie unsterblich ist". Hier wird ihm die Fortdauer nach dem Tode<br />
zu einem Spiele der Phantasie, dem neunzigjährigen Moltke wie dem<br />
achtzigjährigen Goethe. So trete denn freilich die Vernunft (die zuverlässig<br />
ist wie die Naturwissenschaft) in Widerspruch mit manchen ehrwürdigen<br />
Überlieferungen; sie sträube sich gegen das Wunder, des Glaubens liebstes<br />
Kind. (In einer anderen Fassung: "Die Vernunft fühlt sich in vollkommenem<br />
Einklang mit der Moral; aber zweifelnd richtet sie den Blick auf<br />
das Dogma.") Und die Friedensliebe des großen Strategen, seine Verurteilung<br />
der alten Religionskriege — nicht auch der neuen Nationalkriege<br />
— leuchtet mit vollem Agnostizismus aus folgenden Sätzen der<br />
endgültigen Redaktion: „Man kann sich über alles verständigen, nur nicht<br />
über Dinge, an welche das menschliche Begriffsvermögen nicht hinanreicht,<br />
und gerade über solche Begriffe hat man achtzehn Jahrhunderte<br />
hindurch gestritten, hat die Welt verheert, von der Verfolgung der Arianer<br />
an durch dreißigjährige Kriege und bis zu den Scheiterhaufen der Inquisition,<br />
und was ist das Ende aller dieser Kämpfe? — derselbe Zwiespalt<br />
der Meinungen wie vorher." Also: der Erzieher des deutschen Offizierkorps<br />
war in solchen Fragen zu tolerant, zu resigniert, zu skeptisch,<br />
um die Entschiedenheit des „Kulturkampfs" gutzuheißen.<br />
Rom Die katholische Kirche selbst mit ihrer Erbschlauheit machte es so, wie<br />
sie es in der weit drohenderen Gefahr der Reformation gemacht hatte; sie<br />
Modernismus 313<br />
duckte sich zuerst vor dem Sturm, um alle ihre Kräfte nachher zu neuem<br />
Angriff zu sammeln. Die Zukunft wird entscheiden, ob die Neubefestigung<br />
der Papstkirche durch den Antimodernisteneid ebensoviele Jahrzehnte dauern<br />
wird wie einst Jahrhunderte die Festigung durch das Tridentinum und die<br />
Gegenreformation. Zwischen Protestantismus und Wissenschaft gibt es<br />
wenigstens eine scheinbare Versöhnung, auf Grund einer angeblich freien<br />
Forschung; Rom möchte am liebsten noch heute jeden vertilgen, der in<br />
irgendeinem punkte des Wissens oder des Glaubens von dem „heiligen"<br />
Thomas (geboren vor siebenhundert Jahren) abweicht. Die katholische<br />
Kirche ist auch darin sich selber treu und mittelalterlich geblieben, daß sie<br />
den sogenannten Modernismus als eine atheistische Lehre verdammt hat.<br />
In Wahrheit ist der Modernismus eine durchaus religiöse Bewegung<br />
innerhalb des Kreises der wissenschaftlich gebildeten katholischen Theologen,<br />
eine zu spät gekommene Reformation, die nirgends das Volk hinter sich<br />
hat, weder in Amerika noch in Frankreich, weder in Italien noch in Deutschland.<br />
Nur weil der letzte Papst die Schriftsteller dieser Richtung als werdende<br />
Atheisten auf den Index gesetzt hat, muß ich mich mit dieser Angelegenheit<br />
beschäftigen, widerwillig genug.<br />
Natürlich behaupten auch die Modernisten, daß sie die echte Lehre Modernis-<br />
Christi wieder herstellen wollen gegenüber der ultramontanen römischen<br />
Kirche, deren falsche Dogmen und deren unberechtigte Macht zuerst von<br />
Gregor VII. begründet und durch das Unfehlbarkeitsdogma vollendet<br />
worden sind. Die modernistischen Theologen bekämpfen die neuen Dogmen<br />
und die Ansprüche Roms, haben von der protestantischen Theologie einige<br />
historisch-kritische Methode entlehnt, haben aber dem Ultramontanismus<br />
gegenüber, eben aus Mangel an Gefolgschaft, eine noch so kleine eigene<br />
Kirche nicht zu stiften vermocht. Für uns ist der Modernismus dazu verurteilt,<br />
eine Halbheit zu bleiben; er glaubt wissenschaftliche Kritik zu üben,<br />
wenn er die Unfehlbarkeit des Papstes und andere neue Lehrsätze für unbegründet<br />
hält, übrigens aber sogar vor der Dogmengeschichte Harnacks<br />
zurückschreckt; er hält sich selbst für modern, weil er im 20. Jahrhundert<br />
die Metaphysik des heiligen Thomas für veraltet erklärt und den katholischen<br />
Glauben etwa mit Kant und Helmholtz versöhnen möchte. Als ob Glaube<br />
und Wissen sich überhaupt noch vereinigen ließen.<br />
Die Männer des Modernismus sind als Menschen erfreuliche Erscheinungen,<br />
obgleich sie mit ihren leise ketzerischen Gedanken erst hervorzutreten<br />
wagten, als mit der Thronbesteigung von Leo XIII. wieder einmal<br />
eine liberale Ära für die Kirche heraufzukommen schien. Freilich war<br />
diese Hoffnung ein Irrtum; neue Päpste werden mit dem gleichen unausrottbaren<br />
Optimismus begrüßt, wie neue Könige; Leo XIII. war wissen