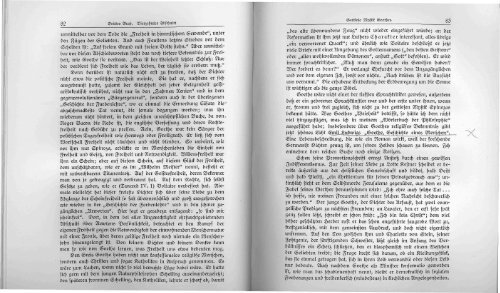Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
82 Drittes Buch. Vierzehnter Abschnitt<br />
unmittelbar vor dem Tode die „Freiheit in himmlischem Gewande", unter<br />
den Zügen der Geliebten. Und auch Faustens letztes Streben vor dem<br />
Scheiden ist: „Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn." Aber unmittelbar<br />
vor diesen Abschiedsworten steht das noch tiefere Bekenntnis zur Freiheit,<br />
wie Goethe sie verstand. „Das ist der Weisheit letzter Schluß: Nur<br />
der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß."<br />
Denn darüber ist natürlich nicht erst zu streiten, daß der Dichter<br />
nicht etwa die politische Freiheit meinte. Die hat er, nachdem er sich<br />
ausgebraust hatte, zusamt der Gleichheit bei jeder Gelegenheit geistaristokratisch<br />
verhöhnt, nicht nur in den "Zahmen Xenien" und in dem<br />
gegenrevolutionären „Bürgergeneral", sondern auch in der überlegenen<br />
"Geschichte der Farbenlehre", wo er einmal die Ermordung Cäsars die<br />
abgeschmackteste Tat nennt, die jemals begangen worden; was ihn<br />
wiederum nicht hindert, in dem gleichen unerschöpflichen Buche, da von<br />
Roger Bacon die Rede ist, die englische Verfassung und deren Rechtsfreiheit<br />
nach Gebühr zu preisen. Nein, Goethe war kein Sänger der<br />
politischen Tagesfreiheit wie Herwegh oder Freiligrath. Er ließ sich vom<br />
Wortschall Freiheit nicht täuschen und nicht blenden. So unbeirrt, wie<br />
vor ihm nur Spinoza, erblickte er im Menschenleben die Einheit von<br />
Freiheit und Gesetz, von Freiheit und Notwendigkeit. Willensfreiheit war<br />
ihm ein Schein; aber auf diesem Schein, auf diesem Glück der Freiheit,<br />
dem unschätzbaren, wie er es im „Wilhelm Meister" nennt, besteht er<br />
mit unbrechbarem Titanentrotz. Auf der Geistesfreiheit, deren Bekenner<br />
man von je gekreuzigt und verbrannt hat. Auf dem Rechte, sich selbst<br />
Gesetze zu geben, wie er (Tancred IV, 1) Voltaire verbessert hat. Niemals<br />
vielleicht hat dieser freieste Dichter sich über seine Liebe zu dem<br />
Abglanze der Scheinfreiheit so fast übermenschlich und groß ausgesprochen<br />
wie wieder in der "Geschichte der Farbenlehre" und in den schwer zugänglichen<br />
"Urworten". Hier sagt er geradezu entsagend: "so sind wir<br />
scheinfrei". Dort, in dem bei aller Ungerechtigkeit ehrfurchtgebietenden<br />
Abschnitt über Newtons Persönlichkeit, betrachtet er den Kampf der<br />
eigenen Freiheit gegen die Notwendigkeit der einwohnenden Menschennatur<br />
mit einer Ironie, über deren geistige Freiheit noch niemals ein Menschensohn<br />
hinausgelangt ist. Von keinem Dichter und keinem Denker kann<br />
man so wie von Goethe lernen, was Freiheit uns etwa bedeuten mag.<br />
Den Greis Goethe haben nicht nur konfessionslos religiöse Menschen,<br />
sondern auch Christen und sogar Katholiken in Anspruch genommen. Es<br />
wäre zum Lachen, wenn nicht so viel bewußte Lüge dabei wäre. Er hatte<br />
sich gern mit dem jungen Naturphilosophen Schelling auseinandergesetzt;<br />
den späteren frommen Schelling, den Katholiken, lehnte er scharf ab, damit<br />
Gottlose Mystik Goethes 83<br />
"das alte überwundene Zeug" nicht wieder eingeführt würde; an der<br />
Reformation ist ihm jetzt nur Luthers Charakter interessant, alles übrige<br />
"ein verworrener Quark"; und ähnlich wie Voltaire beschließt er jetzt<br />
viele Briefe mit einer Umgehung des Gottesnamens ("den besten Geistern"<br />
oder "allen wohlwollenden Dämonen", anstatt "Gott" befohlen). Er wird<br />
immer sprachkritischer. „Muß man denn gerade ein Gewissen haben?<br />
Wer fordert es denn?" Er verlangt Ehrfurcht vor dem Unzugänglichen<br />
und vor dem eigenen Ich, sonst vor nichts. "Nach drüben ist die Aussicht<br />
uns verrannt." Die erhabene Entdeckung der Erdbewegung um die Sonne<br />
ist wichtiger als die ganze Bibel.<br />
Goethe wäre nicht einer der tiefsten Sprachkritiker gewesen, außerdem<br />
daß er ein geborener Sprachkünstler war und der erste unter ihnen, wenn<br />
er, fromm und frei zugleich, sich nicht zu der gottlosen Mystik Spinozas<br />
bekannt hätte. Was Goethes "Weisheit" betrifft, so hätte ich dem nicht<br />
viel hinzuzufügen, was ich in meinem "Wörterbuch der Philosophie"<br />
ausgeführt habe; insbesondere über Goethes religiöses Bekenntnis gibt<br />
jetzt schönes Licht Emil Ludwigs „Goethe, Geschichte eines Menschen".<br />
Eine Lebensbeschreibung, die wie ein Roman wirkt, weil der forschende<br />
Germanist Dichter genug ist, um seinen Helden schauen zu können. Ich<br />
entnehme dem reichen Buche noch einige Notizen.<br />
Schon seine Promotionsschrift erregt Anstoß durch einen gewissen<br />
Indifferentismus. Zur Zeit seiner Liebe zu Lotte Kestner scheidet er bereits<br />
äußerlich aus der christlichen Gemeinschaft und bildet, halb Deist<br />
und halb Pietist, „ein Christentum für seinen Privatgebrauch aus"; unkirchlich<br />
steht er dem Selbstmorde Jerusalems gegenüber, aus dem er die<br />
Fabel seines Werther herausspinnen wird: „Ich ehre auch solche Tat . . .<br />
ich hoffe, nie meinen Freunden mit einer solchen Nachricht beschwerlich<br />
zu werden." Der junge Goethe, der Dichter des Urfaust, hat zwei evangelische<br />
Prediger zu nächsten Freunden; an Lavater, den er erst sehr spät<br />
ganz fallen läßt, schreibt er schon früh: „Ich bin kein Christ"; dem viel<br />
höher geschätzten Herder ruft er das schon angeführte saugrobe Wort zu,<br />
kraftgenialisch, mit dem gemeinsten Ausdruck, und doch nicht eigentlich<br />
unfromm. Auf den Ton zwischen ihm und Charlotte von Stein, seiner<br />
Iphigenie, der sänftigenden Schwester, läßt gleich im Anfang des Verhältnisses<br />
ein Scherz schließen, den er blasphemisch mit einem Westchen<br />
der Geliebten treibt; die Frage dreht sich darum, ob ein Kleidungsstück,<br />
das sie einmal getragen hat, sich in ihren Leib verwandle oder diesen Leib<br />
nur bedeute. Auch nachdem Goethe als Minister konservativ geworden<br />
ist, wie man das schablonenhaft nennt, bleibt er demokratisch in sozialen<br />
Forderungen und freidenkerisch (mindestens) in kirchlichen Angelegenheiten.