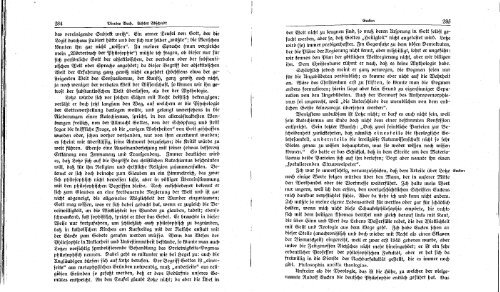Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
284 Viertes Buch. Achter Abschnitt<br />
das vereinigende Subjekt weiß". Ein armer Teufel von Gott, der die<br />
Logik durchaus studiert hätte und der sich nur selber "wüßte"; die Menschen<br />
könnten ihn gar nicht "wissen". In meiner Sprache (man vergleiche<br />
mein "Wörterbuch der Philosophie") müßte ich fragen, ob dieser nur für<br />
sich persönliche Gott der adjektivischen, der verbalen oder der substantivischen<br />
Welt oder Sprache angehört; da dieser Begriff der adjektivischen<br />
Welt der Erfahrung ganz gewiß nicht angehört (höchstens etwa der gesteigerten<br />
Welt des Sensualismus, der Kunst), ganz gewiß auch nicht,<br />
ja noch weniger der verbalen Welt der Wissenschaft, so können wir ihn getrost<br />
der substantivischen Welt überlassen, als der der Mythologie.<br />
Lotze würde sich vor solchen Sätzen mit Recht deistisch bekreuzigen;<br />
verläßt er doch jetzt langsam den Weg, auf welchem er die Psychologie<br />
der Gottesvorstellung darlegen wollte, und gelangt unversehens in die<br />
Niederungen eines Katechismus, spricht, in den allerabstraktesten Wendungen<br />
freilich, von der Allmacht Gottes, von der Schöpfung und stellt<br />
sogar die kniffliche Frage, ob die "ewigen Wahrheiten" von Gott geschaffen<br />
wurden oder, schon vorher vorhanden, nur von ihm anerkannt wurden;<br />
es scheint mir überflüssig, seine Antwort herzusetzen; die Kritik würde zu<br />
weit führen. Ebenso eine Auseinandersetzung mit seiner (etwas besseren)<br />
Erklärung von Immanenz und Transzendenz. Immer deutlicher wird<br />
es, daß Lotze sich auf die Begriffe des christlichen Katechismus beschränken<br />
will, daß für ihn Religion und christliche Religion zusammenfallen. Bekennt<br />
er sich doch beinahe zum Glauben an ein Himmelreich, das zwar<br />
sich philosophisch nicht beweisen lasse, aber in völliger Übereinstimmung<br />
mit den philosophischen Begriffen bleibe. Noch entschiedener bekennt er<br />
sich zum Glauben an eine fortdauernde Regierung der Welt und ist gar<br />
nicht abgeneigt, die allgemeine Möglichkeit der Wunder einzuräumen;<br />
Gott mag wissen, was er sich dabei gedacht hat, wenn er zugleich die Bereitwilligkeit,<br />
an die Wirklichkeit der Wunder zu glauben, tadelt; ebenso<br />
schwankend, fast sophistisch, spricht er über das Gebet. Er brauchte in dieser<br />
Weise nur fortzufahren, um schließlich auch philosophisch zu begründen,<br />
daß in katholischen Kirchen am Karfreitag mit der Ratsche anstatt mit<br />
der Glocke zum Gebete gerufen werden müsse. Wenn das Wesen der<br />
Philosophie in Unklarheit und Unbestimmtheit bestünde, so könnte man auch<br />
Lotzes vorsichtig symbolisierende Behandlung des Dreieinigkeits-Dogmas<br />
philosophisch nennen. Dabei geht es mitunter wie bei Hegel zu: auch die<br />
Ungläubigen dürfen sich auf Lotze berufen. Der Begriff Gottes ist "einerseits"<br />
aus metaphysischen Gründen notwendig, muß "anderseits" aus religiösen<br />
Gründen so gefaßt werden, daß er dem Bedürfnis unseres Gemütes<br />
entspricht. An den Teufel glaubt Lotze nicht; da aber die Übel in<br />
Eucken 285<br />
der Welt nicht zu leugnen sind, so muß deren Ursprung in Gott selbst gesucht<br />
werden, aber so, daß Gottes "Heiligkeit" nicht angetastet wird. Lotze<br />
wird (so) immer predigerhafter. Im Gegensatze zu dem bösen Demokraten,<br />
der die Pläne der Regierung nicht kennt, aber mißbilligt, lehrt er ungefähr:<br />
wir kennen den Plan der göttlichen Weltregierung nicht, aber wir billigen<br />
ihn. Dem Christentume rühmt er nach, daß es keine Mythologie habe.<br />
Schließlich jedoch meint er ganz verwegen, die Dogmen seien nur<br />
für die Ungebildeten verbindlich; es komme aber nicht auf die Wahrheit<br />
an. Wäre das Christentum erst zu stiften, so könnte man die Dogmen<br />
anders formulieren; hierin liege aber kein Grund zu eigensinniger Separation<br />
von den Ungebildeten. Auch der Vorwurf des Anthropomorphismus<br />
sei ungerecht, weil "die Unterschiede des unendlichen von dem endlichen<br />
Geiste keineswegs übersehen werden".<br />
Wenigstens unduldsam ist Lotze nicht; er darf es auch nicht sein, weil<br />
sein Katechismus am Ende doch nicht dem einer bestimmten Konfession<br />
entspricht. Sein letzter Wunsch: "Daß zwei feindliche Parteien zur Bescheidenheit<br />
zurückkehrten, daß nämlich einesteils die theologische Gelehrsamkeit,<br />
andernteils die irreligiöse Naturwissenschaft nicht so sehr<br />
Vieles genau zu wissen behaupteten, was sie weder wissen noch wissen<br />
können." So hatte er das Schicksal, daß in dem Streite um den Materialismus<br />
beide Parteien sich auf ihn beriefen; Vogt aber nannte ihn einen<br />
"spekulierenden Struwwelpeter".<br />
Ich war so unvorsichtig, vorauszuschicken, daß dem Urteile über Lotze Eucken<br />
noch einige Worte folgen würden über den Mann, der in unserer Mitte<br />
den Worthandel oder die Wortmesse weiterführt. Ich halte mein Wort<br />
nur ungern, weil ich den ersten, den wortgeschichtlichen Schriften Euckens<br />
mich dankbar verpflichtet fühle. Aber da stehe ich und kann nicht anders.<br />
Ich müßte ja meine eigene Lebensarbeit für wertlos oder gar für schädlich<br />
halten, wenn mich nicht diese Schaukelphilosophie empörte, die rechts<br />
sich mit dem heiligen Thomas berührt und gleich darauf links mit Kant,<br />
die über Sinn und Wert des Lebens Wasserfälle redet, die der Wirklichkeit<br />
mit Geist und Noologie aus dem Wege geht. Ich habe Eucken schon an<br />
dieser Stelle (anachronistisch und doch wieder mit Recht als einen Sklaven<br />
der Bismarckzeit) eingereiht, weil er zwar erst 1846 geboren wurde, aber<br />
unter die Zeitgenossen Nietzsches nicht mehr hineingehört; er ist ein sehr<br />
ordentlicher Professor der philosophischen Fakultät, aber er hat sich da<br />
freiwillig in die Dienste der Nachbarfakultät gestellt, die es immer noch<br />
gibt. Philosophia ancilla theologiae.<br />
Unfreier als die Theologie, das ist die Höhe, zu welcher der vielgenannte<br />
Rudolf Eucken die deutsche Philosophie endlich geführt hat. Das