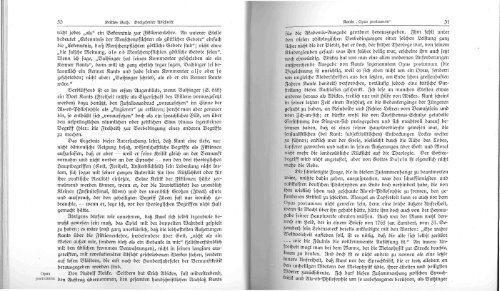Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
30 Drittes Buch. Dreizehnter Abschnitt<br />
nicht jedes "als" ein Bekenntnis zur Fiktionenlehre. An Unserer Stelle<br />
bedeutet "Erkenntnis der Menschenpflichten als göttlicher Gebote" einfach<br />
die "Erkenntnis, daß Menschenpflichten göttliche Gebote sind"; nicht etwa<br />
„die falsche Meinung, als ob Menschenpflichten göttliche Gebote seien".<br />
Wenn ich sage, "Vaihinger hat seinen Kommentar geschrieben als ein<br />
Kenner Kants", dann will ich ganz ehrlich sogar sagen, Vaihinger sei bekanntlich<br />
ein Kenner Kants und habe seinen Kommentar also oder so<br />
geschrieben; nicht aber: "Vaihinger schrieb, als ob er ein Kenner Kants<br />
wäre."<br />
Verblüffend ist es im ersten Augenblicke, wenn Vaihinger (S. 648)<br />
ein Wort Kants (Freiheit müsse als Eigenschaft des Willens vorausgesetzt<br />
werden) dazu benützt, den Zufallsausdruck "voraussetzen" im Sinne der<br />
Als-ob-Philosophie als "fingieren" zu erklären; horcht man aber genauer<br />
hin, so enthüllt sich "voraussetzen" doch als ein sprachliches Bild, um über<br />
den ursprünglichen räumlichen oder zeitlichen Sinn hinaus irgendeinen<br />
Begriff (hier: die Freiheit) zur Vorbedingung eines anderen Begriffs<br />
zu machen.<br />
Das Ergebnis dieser Untersuchung lehrt, daß Kant eine tiefe, nur<br />
nicht dämonische Neigung besaß, wissenschaftliche Begriffe als Fiktionen<br />
aufzufassen, daß er aber — weil er seine Kritik gleich an der Vernunft<br />
vornahm und nicht vorher an der Sprache — von den drei theologischen<br />
Hauptbegriffen (Gott, Freiheit, Unsterblichkeit) sein Lebenlang nicht loskam,<br />
sich sogar mit seiner ganzen Autorität für ihre Nützlichkeit oder für<br />
ihre praktische Realität einsetzte. Seine Kritik der Fiktionen hätte zermalmend<br />
werden können, wenn er, der die Unwirklichkeit des unendlich<br />
Kleinen (Infinitesimal, Atom) und des unendlich Großen (Ideal) ahnte<br />
und aussprach, der den geheiligten Begriff Ideen fast nur ironisch gebrauchte,<br />
— wenn er, sage ich, vor den theologischen Begriffen nicht Halt<br />
gemacht hätte.<br />
Übrigens dürfen wir annehmen, daß Kant sich selbst irgendwie bewußt<br />
gewesen sein muß, das Spiel mit der doppelten Wahrheit gespielt<br />
zu haben; es wäre sonst ganz unerklärlich, daß die lebhaftesten Äußerungen<br />
Kants über die Fiktionenlehre, insbesondere über Gott, "nicht als ein<br />
Wesen außer mir, sondern bloß als ein Gedanke in mir" (selbstverständlich<br />
mit den üblichen frommen Verwahrungen), nicht in seinen langsam ausgereiften,<br />
mit revolutionärer Absicht geschriebenen Werken stehen, sondern<br />
auf losen Blättern, die erst nach der Hundertjahrfeier der Vernunftkritik<br />
herausgegeben worden sind.<br />
Von Rudolf Reicke. Seitdem hat Erich Adickes, fast widerstrebend,<br />
den Auftrag übernommen, den gesamten handschriftlichen Nachlaß Kants<br />
Kants "Opus postumum" 31<br />
für die Akademie-Ausgabe geordnet herauszugeben. Ihm fehlt unter<br />
den vielen philologischen Vorbedingungen einer solchen Leistung ganz<br />
sicher nicht die der Pietät, hat er doch, der früher Theologe war, von seinem<br />
Kinderglauben gesagt: was ihm früher heilig war, erscheine ihm auch jetzt<br />
noch ehrwürdig. Adickes hat uns nun eine allen modernen Anforderungen<br />
entsprechende Ausgabe von Kants sogenanntem Opus postumum (die<br />
Bezeichnung ist unrichtig, weil es sich eben nicht um ein Opus, sondern<br />
um ungleiche Niederschriften aus den letzten, am Ende schon greisenhaften<br />
Jahren Kants handelt) versprochen, vorläufig jedoch eine kritische Darstellung<br />
dieses Nachlasses geschenkt. Ich lese an manchen Stellen etwas<br />
anderes heraus als Adickes, freilich nur mit Hilfe von Adickes. Kant scheint<br />
in seiner letzten Zeit einen Anschluß an die Gedankengänge der Jüngeren<br />
gesucht zu haben, an Reinholds und Fichtes Lehren vom Bewußtsein und<br />
vom Ich-an-sich; er dürfte wohl die von Änesidemus-Schulze getadelte<br />
Einführung des Ding-an-sich preisgegeben und sich machtvoll darauf besonnen<br />
haben, daß es eines seiner Hauptverdienste gewesen war, die<br />
sensualistischen (bei Kant: subjektivistischen) Entdeckungen Lockes weiter<br />
zu führen; endlich war der Greis, vielleicht durch die Nähe des Todes,<br />
tapferer geworden und nahm in seinen Äußerungen über Gott und Moral<br />
nicht mehr die landesübliche Rücksicht auf die Theologie. Der Gottesbegriff<br />
wird nicht angetastet, aber von Gottes Dasein ist eigentlich nicht<br />
mehr die Rede.<br />
Die schwierigste Frage, die in diesem Zusammenhange zu beantworten<br />
wäre, müßte dahin gehen, auszusprechen, was den scharfsinnigsten und<br />
radikalsten deutschen Philosophen am Ende doch verhindert habe, die von<br />
ihm wirklich schon nah geschaute Als-ob-Philosophie zu formen, den gefundenen<br />
Kristall zu schleifen. Mangel an Tapferkeit kann es auch vor dem<br />
Opus postumum nicht gewesen sein, denn eine solche äußere Unfreiheit,<br />
wenn sie Macht über ihn gehabt hatte, hätte ihm doch auch von der Herausgabe<br />
seiner Hauptwerke abraten müssen. Auch war der Mann wohl dennoch<br />
ein Held, der in einem Briefe von 1765 (an Lambert, vom 31. Dezember)<br />
sein Lebenswerk bereits ankündigte mit den Worten: „Ehe wahre<br />
Weltweisheit aufleben soll, ist es nötig, daß die alte sich selbst zerstöre<br />
. . . wie die Fäulnis die vollkommenste Auflösung ist." An innere Unfreiheit<br />
wagt man bei dem Manne, der die Metaphysik zur Strecke brachte,<br />
kaum zu denken. Und doch ist es nicht anders zu nennen als eine letzte<br />
innere Unfreiheit, daß Kant vor der Sprachkritik, die er trotz alledem an<br />
den unheiligen Wörtern der Metaphysik übte, ihrer ältesten und heiligsten<br />
Wörter zurückscheute. Ich darf diesen Zusammenhang zwischen Sprachkritik<br />
und Als-ob-Philosophie um so unbefangener berühren, als Vaihinger