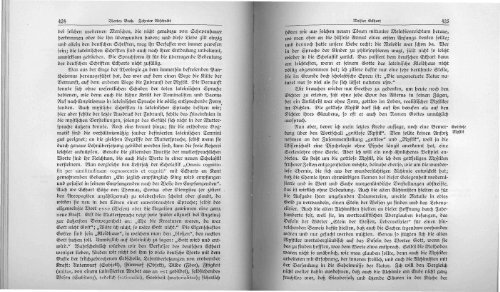Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
424 Viertes Buch. Zehnter Abschnitt<br />
bei solchen modernen Menschen, die nicht geradezu von Schopenhauer<br />
herkommen oder die ihn überwunden haben; und diese Liebe gilt einzig<br />
und allein den deutschen Schriften, mag ihr Verfasser wer immer gewesen<br />
sein; die lateinischen Schriften sind auch nach ihrer Entdeckung unbekannt,<br />
unwirksam geblieben. Die Sprachform ist für die überragende Bedeutung<br />
der deutschen Schriften Eckharts nicht zufällig.<br />
Was aus der Enge der Theologie zu dem immerhin befreienden Pantheismus<br />
herausgeführt hat, das war auf dem einen Wege die Kälte der<br />
Vernunft, auf dem anderen Wege die Inbrunst der Mystik. Die Vernunft<br />
konnte sich ohne wesentlichen Schaden der toten lateinischen Sprache<br />
bedienen, wie denn auch die kühne Kritik der Nominalisten und Bacons<br />
Ruf nach Empirismus in lateinischer Sprache die völlig entsprechende Form<br />
fanden. Auch mystische Schriften in lateinischer Sprache besitzen wir;<br />
hier aber fehlte der letzte Ausdruck der Inbrunst, fehlte das Hineinknien in<br />
die mystischen Vorstellungen, solange das Gefühl sich nicht in der Muttersprache<br />
äußern konnte. Noch eins kommt hinzu; für die orthodoxe Dogmatik<br />
sind die verhältnismäßig sauber definierten lateinischen Termini<br />
gut geeignet; an die gleichen Begriffe der Muttersprache, selbst wenn sie<br />
durch genaue Lehnübersetzung gebildet worden sind, kann die freie Ketzerei<br />
leichter anknüpfen. Gerade die zitternden Umrisse der muttersprachlichen<br />
Worte sind ihr Reichtum, bis auch diese Worte in einer neuen Scholastik<br />
versteinern. Man vergleiche den Lehrsatz der Scholastik ,,Omnis cognitio<br />
fit per similitudinem cognoscentis et cogniti" mit Eckharts an Kant<br />
gemahnenden Gedanken "Ein jeglich empfänglich Ding wird empfangen<br />
und gefasset in seinem Empfangenden nach der Weise des Empfangenden".<br />
Auch wo Eckhart Sätze von Thomas, Scotus oder Dionysios (er zitiert<br />
den Areopagiten unzähligemal) zu wiederholen scheint oder glaubt, da<br />
wirken sie neu in den Tönen einer unverbrauchten Sprache; selbst das<br />
allgemeinste Wort esse (Wesen) oder die Negation gewinnen eine ganz<br />
neue Kraft. Erst die Muttersprache reizt (wie später allzuoft bei Angelus)<br />
zur äußersten Verwegenheit an: "Ehe die Kreaturen waren, da war<br />
Gott nicht Gott"; "Ware ich nicht, so wäre Gott nicht." Die Eigenschaften<br />
Gottes sind sein "Kleidhaus", in welchem man den "bloßen", den nackten<br />
Gott suchen soll. Unmöglich auf Lateinisch zu sagen: "Gott wird und entwird."<br />
Wahrscheinlich würden wir den Verfasser des deutschen Eckhart<br />
weniger lieben, fänden wir nicht bei ihm so viele deutsche Worte mit dem<br />
Dufte der frischgebrochenen Erdscholle, Lehnübersetzungen von erobernder<br />
Kraft: Unterwurf (Subjekt), Fürwurf (Objekt), Bilde (Idee), Istigkeit<br />
(anitas, von einem latinisierten Araber aus an est gebildet), selbstehendes<br />
Wesen (Substanz), redelich (rationalis), Grobheit (materialitas); sicherlich<br />
Meister Eckhart 425<br />
hören wir aus solchen neuen Tönen mitunter Melodienreichtum heraus,<br />
wo man eher an die hilflose Armut eines ersten Anfangs denken sollte;<br />
und dennoch hatte unsere Liebe recht: die Melodie war schon da. Wer<br />
in der Sprache der Kinder zu philosophieren wagt, fällt nicht so leicht<br />
wieder in die Scholastik zurück. Das passiert dem deutschen Eckhart dann<br />
am leichtesten, wenn er seinem Gotte das lateinische Kleidhaus nicht<br />
völlig abgenommen hat; ich zitiere dafür nur eine sehr berühmte Stelle,<br />
die im Grunde doch scholastische Spreu ist: „Die ungenaturte Natur naturet<br />
nur so viel als sie sich lässet naturen usw."<br />
Wir brauchen wieder nur Goethes zu gedenken, um heute noch den<br />
Dichter zu erleben, fast ohne jede Spur des Alterns in seinen Zügen,<br />
der ein Antichrist war ohne Zorn, gottlos im Leben, realistischer Mystiker<br />
im Dichten. Die gottlose Mystik darf sich auf ihn berufen als auf den<br />
Dichter ihres Glaubens, so oft er auch den Namen Gottes unnützlich<br />
aussprach.<br />
Nun aber, bevor ich mein letztes Kredo aufsage, noch eine Bemer Gottlose<br />
kung über den Wortschall „gottlose Mystik". Man sollte keinen Anstoß<br />
nehmen an der Zusammenstellung „gottlos" und „Mystik", weil ja die<br />
Wissenschaft eine Psychologie ohne Psyche längst anerkannt hat, eine<br />
Seelenlehre ohne Seele. Aber ich will ein noch ähnlicheres Beispiel anbieten.<br />
Es steht um die gottlose Mystik, die ich den gottseligen Mystiken<br />
früherer Zeiten entgegenstellen möchte, beinahe ebenso, wie um die wunderlose<br />
Chemie, die sich aus der wundersüchtigen Alchimie entwickelt hat;<br />
daß die Chemie ihren ehrwürdigen Namen bei dieser Gelegenheit modernisierte<br />
und in Wort und Sache morgenländische Vorstellungen abstreifte,<br />
das ist wirklich ohne Bedeutung. Auch die alten Alchimisten hielten es für<br />
die Aufgabe ihrer ungesunden Träumereien, unedle Metalle in edles<br />
Gold zu verwandeln, einen Stein der Weisen zu finden und das Lebenselixier.<br />
Auch die alten Alchimisten hielten an dieser Hoffnung durch Jahrhunderte<br />
fest, weil sie, im wortrealistischen Aberglauben befangen, das<br />
Dasein der Wörter „Stein der Weisen, Lebenselixier" für einen hinreichenden<br />
Beweis dafür hielten, daß auch die Sachen irgendwo vorhanden<br />
wären und nur gesucht werden müßten. Genau so stützten sich die alten<br />
Mystiker wortabergläubisch auf das Dasein des Wortes Gott, wenn sie<br />
das zu finden hofften, was dem Worte etwa entsprach. Selbst die Methoden<br />
waren nicht so unähnlich, wie man glauben sollte, denn auch die Mystiker<br />
arbeiteten mit Erfahrung, der inneren freilich, und auch die Alchimisten mit<br />
der Versenkung in die Geheimnisse der Natur. Ich will den Vergleich<br />
nicht weiter dahin ausdehnen, daß auch die Alchimie am Ende nicht ganz<br />
fruchtlos war, daß Glaubersalz und ätzende Säuren in der Küche der