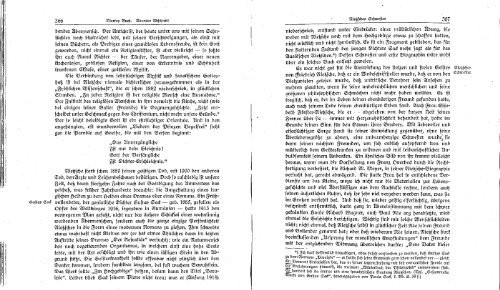Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
366 Viertes Buch. Neunter Abschnitt<br />
bender Übermensch. Der Antichrist, der heute unter uns mit seinen Sehnsüchten<br />
noch blutreicher lebt, mit seinen Verschweigungen, als einst mit<br />
seinen Büchern, als Prediger einer grundlosen Lebensfreude, ist kein Gott<br />
geworden, nicht einmal ein Religionsstifter, ist aber vielleicht — so faßte<br />
ihn auch Raoul Richter — der Täufer, der Namengeber, einer neuen<br />
kirchenlosen, gottlosen Religion, einer von Erkenntnis und Schönheit<br />
trunkenen Ekstase, einer gottlosen Mystik.<br />
Die Verbindung von sehnsüchtiger Mystik und fanatischem Gotteshaß<br />
ist bei Nietzsche niemals dichterischer herausgekommen als in der<br />
"Fröhlichen Wissenschaft", die er schon 1882 niederschrieb, in glücklichen<br />
Stunden. "In jeder Religion ist der religiöse Mensch eine Ausnahme."<br />
Der Instinkt des religiösen Menschen in ihm verwirft die Kirche, nicht (wie<br />
bei einigen seiner Basler Freunde) die Dogmengeschichte. "Jetzt entscheidet<br />
unser Geschmack gegen das Christentum, nicht mehr unsere Gründe."<br />
Der so leicht beleidigte Gott ist ein ehrsüchtiger Orientale. Und in den<br />
angehängten, oft wundervollen "Liedern des Prinzen Vogelfrei" steht<br />
gar die Parodie auf Goethe, die mit den Versen beginnt:<br />
"Das Unvergängliche<br />
Ist nur dein Gleichnis!<br />
Gott der Verfängliche<br />
Ist Dichter-Erschleichnis."<br />
Nietzsche starb schon 1889 seinen geistigen Tod, erst 1900 den anderen<br />
Tod, den Ärzte und Leichenbeschauer bestätigen. Doch so raschlebig ist unsere<br />
Zeit, daß kaum fünfzehn Jahre nach der Beerdigung des Umwerters das<br />
geschah, was früher Jahrhunderte brauchte: die Umgestaltung eines tragischen<br />
Helden zu dem Helden eines Dramas oder eines Romans. Ein Frühvollendeter,<br />
der genialische Dichter Gustav Sack — geb. 1885, gefallen als<br />
Opfer des Weltkrieges 1916, irgendwo in Rumänien — hatte 1913 den<br />
verwegenen Plan gefaßt, nicht nur das äußere Schicksal eines wahnsinnig<br />
werdenden Übermenschen, sondern auch die ganze einzige Persönlichkeit<br />
Nietzsches in die Form eines modernen Romans zu gießen. Ihm schwebte<br />
etwas wahrhaft nicht Kleines vor (er hat etwas Ähnliches dann im letzten<br />
Auftritte seines Dramas "Der Refraktär" versucht): wie ein Naturmensch<br />
den noch vegetierenden Organismus, in welchem einst eine hohe Seele<br />
lebte, mit der Axt erichlägt und ihn wie einen lästigen Stein in den Abgrund<br />
stößt. Die Geisteskrankheit sollte offenbar nicht plötzlich über den<br />
Denker kommen, sondern furchtbar langsam, bei fast wachem Bewußtsein.<br />
Das Werk sollte "Im Hochgebirge" heißen, bekam dann den Titel "Paralyse".<br />
Leider blieb Sack seinem Plane nicht treu; was er (Anfang 1914)<br />
Nietzsches Schwester 367<br />
niederschrieb, entstand unter Eindrücken einer militärischen Übung, die<br />
weder mit Nietzsche noch mit dem Hochgebirge etwas zu schaffen hatten,<br />
nicht wirklich und nicht symbolisch. Es ist ein Fragment geblieben, das für<br />
den flatternden Zustand des jungen Dichters Sack mehr sagt als für das<br />
Auslöschen Nietzsches.*) Dessen Schwester und erste Biographin wäre wohl<br />
über ein solches Buch entsetzt gewesen.<br />
Es war nicht gut für die Auswirkung des stolzen und freien Geistes Nietzsches<br />
von Friedrich Nietzsche, daß er ein Modeschriftsteller wurde, daß er von den<br />
Vielzuvielen gelesen wurde, daß unkritische Verehrer sein Ansehen zu<br />
mehren glaubten, wenn sie seine unbeträchtlichen menschlichen und seine<br />
größeren philosophischen Schwächen nicht wahr haben wollten. Es ist<br />
tragisch, daß er, der im Leben keinen ebenbürtigen Freund gefunden hatte,<br />
auch nach seinem Tode keinen ebenbürtigen Erben fand. Auch Frau Elisabeth<br />
Förster-Nietzsche, die er — abgesehen von der kurzen Zeit seines<br />
Zornes über sie — immer mit Herzenshöflichkeit behandelt hat, hatte im<br />
Grunde keinen Sinn für den Dämon ihres Bruders. Mit liebevoller und<br />
eifersüchtiger Sorge stand sie seiner Entwicklung gegenüber, ohne seine<br />
Überlebensgröße zu ahnen, eine unbarmherzige Schwester wurde sie<br />
dann seinen nächsten Freunden, um sich endlich aufopfernd treu und<br />
mütterlich dem Geisteskranken zu widmen und mit leidenschaftlicher Unduldsamkeit<br />
seinem Andenken. Ein ähnliches Bild von ihr kommt vielleicht<br />
heraus, wenn man die Darstellung von Franz Overbeck durch die Rechtfertigung<br />
verbessert, die Richard M. Meyer, in seiner Nietzsche-Biographie<br />
versucht hat, gerecht abwägend. Die starke Frau hat so entschiedene Verdienste<br />
um das Kleine, wozu ich nicht nur die Materialien zur Lebensgeschichte<br />
und viel Überflüssiges aus dem Nachlasse rechne, sondern auch<br />
seinen äußerlichen Ruhm, daß ihr sehr viel vergeben werden kann, was sie<br />
im Großen verfehlt hat. Und daß sie, wieder geistig eifersüchtig, übrigens<br />
beschränkt antisemitisch, darin ganz in Übereinstimmung mit dem schwer<br />
gekränkten Hause Richard Wagner, auch Paul Rée arg herabsetzte, wird<br />
einmal die Geschichte berichtigen. Wichtig sind mir solche Menschlichkeiten<br />
nicht; nicht einmal, daß Nietzsche selbst in glücklicher Zeit Rée seinen Freund<br />
und Vollender genannt hat; oder daß wiederum Rée seinem Nietzsche stark<br />
beeinflussenden "Ursprung der moralischen Empfindungen" dem Freunde<br />
mit der entzückenden Widmung überreichen durfte: „Dem Vater dieser<br />
*) Ich darf hoffentlich hinzufügen, ohne falsch verstanden zu werden, daß Gustav Sack<br />
zu dem Romane "Paralyse" — er stellte sich seine Entwürfe gern schon vollendet vor — gleich<br />
ein Vorwort hinterlassen hat, das in seiner letzten Fassung mit fast romantischer Ironie auf<br />
die Entlehnungen hinweist, die meinem "Wörterbuch der Philosophie" entnommen sind.<br />
Es handelt sich da immer um eine sprachkritische Deutung Nietzsches. (Vgl. „Gesammelte<br />
Werke von Gustav Sack", herausgegeben von Paula Sack, I. Bd. S. 38 f.)