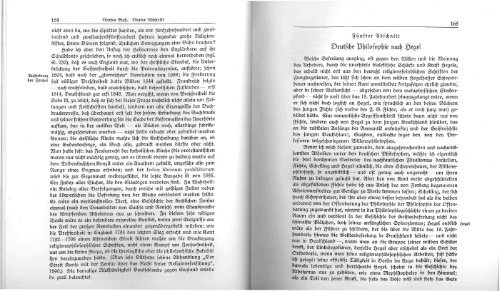Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
164<br />
Viertes Buch. Vierter Abschnitt<br />
nicht eben da, wo die Spötter standen, als vor fünfzehnhundert und zweitausend<br />
und Zweitausendfünfhundert Jahren legendar große Religionsstifter,<br />
ihrem Dämon folgend, ähnlichen Bewegungen eine Bahn brachen?<br />
Habe ich aber den Unfug der Heilsarmee den Engländern auf ihr<br />
Schuldkonto geschrieben, so muß ich endlich noch einmal hervorheben (vgl.<br />
S. 232), daß es auch England war, wo der christliche Skandal, die Unterdrückung<br />
der Geistesfreiheit durch die Präventivzensur, aufhörte; schon<br />
Aufhebung 1694, bald nach der "glorreichen" Revolution von 1688; die Forderung<br />
der Zensur fast völliger Preßfreiheit hatte Milton 1644 gestellt. Frankreich folgte<br />
— nach wechselnden, bald anarchischem bald despotischen Zuständen — erst<br />
1814, Deutschland gar erst 1848. Man vergißt, wenn von Preßfreiheit die<br />
Rede ist, zu leicht, daß es sich bei dieser Frage wahrlich nicht allein um Zeitungen<br />
und Zeitschriften handelt, sondern um alle Erzeugnisse der Buchdrucker<strong>presse</strong>,<br />
daß überhaupt erst seit der hohen Erfindung des Buchdrucks<br />
und seiner frühen Verwertung für die Sache der Reformation das Unerhörte<br />
aufkam, das in der antiken Welt — als Bücher noch, allerdings fabriksmäßig,<br />
abgeschrieben wurden — nicht hatte erdacht oder geduldet werden<br />
können: die christliche Kirche maßte sich die Entscheidung darüber an, ob<br />
eine Gedankenfolge, ein Buch also, gedruckt werden dürfte oder nicht.<br />
Man halte fest: das Zensurrecht der katholischen Kirche (die protestantischen<br />
waren nur nicht mächtig genug, um es überall ebenso zu halten) wurde auf<br />
dem Tridentinischen Konzil unter ein Anathem gestellt, ungefähr also zum<br />
Range eines Dogmas erhoben; und der Index librorum prohibitorum<br />
wird bis zur Gegenwart weitergeführt, die letzte Ausgabe ist von 1895.<br />
Ein Index aller Bücher, die den Gläubigen verboten sind. In Wahrheit:<br />
ein Katalog aller Verfolgungen, durch welche mit geistiger Folter neben<br />
der körperlichen die Befreiung von der Kirche verhindert werden sollte.<br />
Es wäre ein verdienstvolles Werk, eine Geschichte der kirchlichen Zensur<br />
einmal (nach den Vorarbeiten von Sachse und Reusch) vom Standpunkte<br />
des kämpfenden Atheismus aus zu schreiben. In diesem sehr nötigen<br />
Werke wäre es ein besonders reizvolles Kapitel, wenn zwei Ereignisse aus<br />
der Zeit der großen Revolution einander gegenübergestellt würden: wie<br />
die Preßfreiheit in England 1794 den letzten Sieg erfocht und wie Kant<br />
1792—1798 einen lähmenden Streit führen mußte um die Drucklegung<br />
religionsphilosophischer Schriften, nicht einen Kampf um Zensurfreiheit,<br />
nur um die kleine Frage, ob die theologische oder die philosophische Fakultät<br />
ihm dareinzureden hätte. (Man lese Diltheys schöne Abhandlung „Der<br />
Streit Kants mit der Zensur über das Recht freier Religionsforschung",<br />
1890.) Die damalige Rückständigkeit Deutschlands gegen England würde<br />
da grell beleuchtet.<br />
Fünfter Abschnitt<br />
Deutsche Philosophie nach Hegel<br />
Welche Befreiung ausging, oft gegen den Willen und die Meinung<br />
des Urhebers, durch die unerhörte dialektische Schärfe und Kraft Hegels,<br />
das erhellt nicht erst aus den bewußt religionsfeindlichen Schriften der<br />
Junghegelianer, das läßt sich schon an dem wilden Hegelhasser Schopenhauer<br />
nachweisen, der seinen Kant unmittelbar fortzusetzen ehrlich glaubte,<br />
aber in seiner Weltansicht — abgesehen von dem metaphysischen Steckenpferd<br />
— nicht so weit über das 18. Jahrhundert hinausgelangt wäre, wenn<br />
er sich nicht doch logisch an Hegel, wie sprachlich an den besten Büchern<br />
des jungen Fichte (ich meine des J. G. Fichte, als er noch jung war) gebildet<br />
hätte. Eine romantische Begriffsathletik führte dann nicht nur von<br />
Fichte, sondern auch von Hegel zu dem jungen Deutschland hinüber, das<br />
an die radikalen Anfänge der Romantik anknüpfte; und der Geistreichste<br />
des jungen Deutschland, Gutzkow, entdeckte sogar den von den Professoren<br />
totgeschwiegenen Willensphilosophen.<br />
Bevor ich mich diesem zuwende, dem ausgesprochensten und nachwirksamsten<br />
Atheisten unter den deutschen Philosophen, müßte ich eigentlich<br />
die drei berühmten Vertreter des nachkantischen Idealismus darstellen,<br />
Fichte, Schelling und Hegel nämlich, die eben Schopenhauer, der Willensphilosoph,<br />
so unerbittlich — und oft genug auch ungerecht —um ihren<br />
Ruhm zu bringen gesucht hat. Aber den von Kant mehr abgeschüttelten<br />
als abgefallenen Fichte habe ich aus Anlaß des von Forberg begonnenen<br />
Atheismusstreites zur Genüge zu Worte kommen lassen; Schelling, der sich<br />
(nach Schopenhauer, der ihn aber etwas besser behandelt hat als die beiden<br />
anderen) von der Offenbarung der Philosophie der Philosophie der Offenbarung<br />
zugewandt hat, nimmt in der Philosophiegeschichte einen zu breiten<br />
Raum ein und verdient in der Geschichte der Geistesbefreiung nicht das<br />
schmalste Plätzchen, trotz seines anfänglichen Spinozismus; Hegel endlich Hegel<br />
wäre als der Führer zu schildern, der bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
hinaus die Geistesbefreiung in Deutschland leitete — und nicht<br />
nur in Deutschland —, wenn man an die Gruppe seiner wilden Schüler<br />
denkt, der Linkshegelianer, derselbe Hegel aber erscheint als ein Hort der<br />
Orthodoxie, wenn man seine religionsphilosophischen Arbeiten, fast hätte<br />
ich gesagt: seine offiziöse Tätigkeit in Berlin im Auge behält; dieser, der<br />
damals lebendige und herrschende Hegel, scheint in die Geschichte des<br />
Atheismus nur zu gehören, wie etwa Mephistopheles in den Himmel:<br />
als ein Teil von jener K r a f t , die stets das Böse will und stets das Gute<br />
165