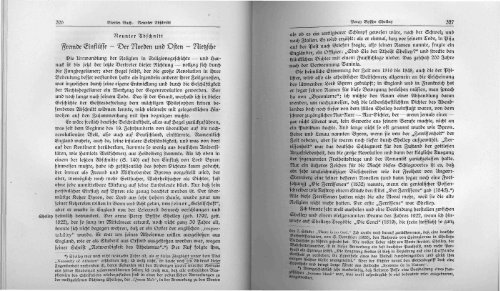Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
326 Viertes Buch. Neunter Abschnitt<br />
Neunter Abschnitt<br />
Fremde Einflüsse — Der Norden und Osten — Nietzsche<br />
Die Umwandlung der Religion in Religionsgeschichte — und Harnack<br />
ist bis jetzt der letzte Vertreter dieser Richtung — vollzog sich durch<br />
die Junghegelianer; aber Hegel selbst, der die große Revolution in ihrer<br />
Bedeutung besser verstanden hatte als irgendein anderer ihrer Zeitgenossen,<br />
war inzwischen durch seine eigene Entwicklung und durch die Geschäftigkeit<br />
der Rechtshegelianer ein Werkzeug der Gegenrevolution geworden. Vor<br />
und noch lange nach seinem Tode. Das ist der Grund, weshalb ich in dieser<br />
Geschichte der Geistesbefreiung dem mächtigen Philosophen keinen besonderen<br />
Abschnitt widmen konnte, mich vielmehr mit gelegentlichen Hinweisen<br />
auf den Zusammenhang mit ihm begnügen mußte.<br />
Es wäre freilich deutsche Beschränktheit, alles auf Hegel zurückzuführen,<br />
was seit dem Beginne des 19. Jahrhunderts von überallher auf die nachrevolutionäre<br />
Welt, also auch auf Deutschland, einstürmte. Namentlich<br />
England wahrte, auch da, seine insulare Selbständigkeit, und was von dort<br />
auf den Kontinent herüberkam, stammte so wenig aus deutschen Universitäten,<br />
wie Hamlets Weltschmerz aus Heidelberg stammte. Als ich oben in<br />
einem der letzten Abschnitte (S. 140) auf den Einfluß von Lord Byron<br />
hinweisen mußte, habe ich geflissentlich des hohen Dichters kaum gedacht,<br />
der immer als Freund und Mitstrebender Byrons vorgestellt wird, der<br />
aber, womöglich noch mehr Gottsucher, Wahrheitsucher als Dichter, fast<br />
ohne jede unmittelbare Wirkung auf seine Landsleute blieb. Nur daß sein<br />
persönlicher Einfluß auf Byron nie genug beachtet worden ist. Der übermütige<br />
Ketzer Byron, der Lord aus sehr hohem Hause, wurde zwar um<br />
seiner Ketzereien willen in Bann und Acht getan, von seiner "Gesellschaft",<br />
aber er wurde in England von der Leserwelt dennoch verschlungen und<br />
Shelley heimlich bewundert. Der arme Percy Bysshe Shelley (geb. 1792, gest.<br />
1822), der so jung im Mittelmeer ertrank, noch nicht ganz 30 Jahre alt,<br />
konnte sich nicht dagegen wehren, daß er ein Opfer der englischen "respectability"<br />
wurde. Er war um seines Atheismus willen ausgestoßen aus<br />
England, wie er als Student aus Oxford ausgestoßen worden war, wegen<br />
seiner Schrift "Notwendigkeit des Atheismus".*) Der Ruf folgte ihm,<br />
*) Shelley war noch nicht neunzehn Jahre alt, als er dieses Flugblatt unter dem Titel<br />
"Necessity of Atheism" erscheinen ließ; ich weiß nicht, ob heute noch ein Abdruck dieser<br />
Jugendarbeit vorhanden ist, deren Gedanken mit den Tendenzen zweier unreifer Romane<br />
aus seiner Knabenzeit zusammenstimmen sollen; ich weiß nur, daß alle entsetzlichen Blasphemien<br />
des Schriftchens wiederzufinden sind in einer der pedantischen Anmerkungen zu<br />
der meistgelesenen Dichtung Shelleys, der "Queen Mab", in der Anmerkung zu den Worten<br />
Percy Bysshe Shelley 327<br />
als ob es ein untilgbarer Schimpf gewesen wäre, nach der Schweiz und<br />
nach Italien. Es wird erzählt: als er einmal, kurz vor seinem Tode, in Pisa<br />
auf der Post nach Briefen fragte, also seinen Namen nannte, fragte ein<br />
Engländer, ein Offizier. „Sind Sie der Atheist Shelley?" und streckte den<br />
kränklichen Dichter mit einem Faustschlage nieder. Das geschah 200 Jahre<br />
nach der Verbrennung Vaninis.<br />
Die heimliche Stimmung der Zeit von 1819 bis 1848, auch die der Philister,<br />
wird also als atheistischer Weltschmerz allgemein an die Erscheinung<br />
des lärmenden Lord Byron geknüpft; in England und in Frankreich hat<br />
er sogar seinen Namen für diese Bewegung herleihen müssen, man sprach<br />
da von „Byronisme"; ich müßte den Raum einer Abhandlung daran<br />
wenden, um nachzuweisen, daß die leidenschaftlichsten Dichter des Abendlandes<br />
doch noch tiefer von dem stillen Shelley beeinflußt waren, von dem<br />
schwer zugänglichen Nur-Narr—Nur-Dichter, der — wenn jemals einer —<br />
gar nicht Literat war, kein Gewerbe aus seinem Berufe machte, nicht an<br />
ein Publikum dachte. Und lange nicht so oft genannt wurde wie Byron.<br />
Heine und Lenau nannten Byron, wenn sie von der "Zerrissenheit" der<br />
Zeit redeten, aber sie waren noch tiefer durch Shelley aufgewühlt. „Zerrissenheit"<br />
war das deutsche Schlagwort für den Zustand der gottlosen<br />
Unzufriedenheit, den die große Revolution und dann der klägliche Ausgang<br />
der sogenannten Freiheitskriege und der Romantik zurückgelassen hatte.<br />
Nur ein äußeres Zeichen für die Macht dieses Schlagwortes ist es, daß<br />
ein sehr ungleichmäßiger Vielschreiber wie der Freiherr von Ungern-<br />
Sternberg eine seiner besseren Novellen (und dann sogar noch eine Fortsetzung)<br />
"Die Zerrissenen" (1832) nannte, wenn ein genialischer Possenschreiber<br />
wie Nestroy einem Stücke den Titel „Der Zerrissene" gab (1845).*)<br />
Alle diese Zerrissenen hatten nicht die alte Moral mehr, weil sie die alte<br />
Religion nicht mehr hatten. Der erste "Zerrissene" war Shelley.<br />
Ich könnte sehr weit ausholen und eine Verbindung herstellen zwischen<br />
Shelley und einem vielgenannten Drama des Jahres 1922, wenn ich hinwiese<br />
auf Shelleys Tragödie "Die Cenci" (1819), die (rein stofflich) so ganz<br />
des 7. Stücks: "There is no God." Ich werde noch darauf zurückkommen, daß eine deutsche<br />
Doktordissertation, von S. Bernthsen (1900), den Nachweis von Spinozismus in Shelleys<br />
Weltansicht zu führen gesucht h a t . Wir wollen lieber nicht um Worte streiten. Shelley, der<br />
Wahrheitsfanatiker, ist in dieser Anmerkung ein fast deutscher Pantheist, noch mehr Pantheist<br />
als Spinoza selbst. "Die Leugnung Gottes ist bloß in Beziehung auf eine schaffende<br />
Gottheit zu verstehen; die Hypothese eines das Weltall durchdringenden und gleich ihm<br />
ewigen Geistes bleibt unangetastet." Aber der Dichter nennt den Gottesbegriff doch eine<br />
Hypothese und bringt lange Zitate aus Holbachs "Système de la Nature".<br />
*) Wortgeschichtlich sehr merkwürdig, daß Nestroys Posse eine Bearbeitung eines französischen<br />
"homme blasé" war, was wohl ursprünglich so viel bedeutete wie: ausgebrannt,<br />
a u s g e t r o c k n e t .