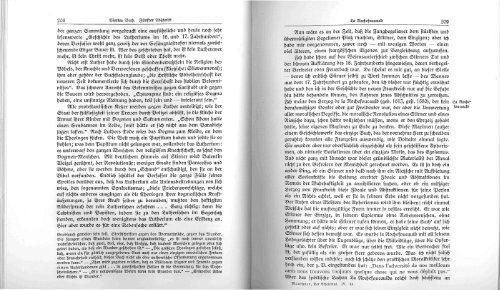Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
208 Viertes Buch. Fünfter Abschnitt<br />
der ganzen Sammlung vorgedruckt eine ausführliche und heute noch sehr<br />
lesenswerte "Geschichte des Luthertums im 16. und 17. Jahrhundert",<br />
deren Verfasser wohl ganz gewiß der vor Gefängnisstrafen niemals zurückscheuende<br />
Edgar Bauer ist. Wer das geschrieben hat, der ist kein Lutheraner<br />
mehr, ist kein Christ mehr, ist kein Deist oder Theist mehr.<br />
Nicht erst Luther habe durch sein Sündenbewußtsein die Religion des<br />
Pöbels, der Knechte und Verworfenen geschaffen (Nietzsche: Sklavenmoral);<br />
ihm aber gehöre der Buchstabenglaube; "die christliche Pöbelherrschaft der<br />
neueren Zeit dokumentierte sich durch die Herrschaft des stabilen Bekenntnisses".<br />
Das schwere Unrecht des Bekenntnisses gegen Carlstadt und gegen<br />
die Bauern wird hervorgehoben. "Synonyme sind: ein religiöses Dogma<br />
haben, eine unsinnige Meinung haben, toll sein und — intolerant sein."<br />
Alle protestantischen Ketzer werden gegen Luther verteidigt; wie der<br />
Staat der Hilflosigkeit seiner Treuen durch Polizei abhilft, so die Kirche der<br />
Armut ihrer Kinder mit Dogmen und Sakramenten. "Schon Adam hatte<br />
einen Gendarmen im Leibe, sonst hätte er sich nicht aus dem Paradiese<br />
jagen lassen." Nach Luthers Tode wies das Dogma zum Kleide, an dem<br />
die Theologen flicken. Die Welt muß ein Papsttum haben und sollte sie es<br />
stehlen; was dem Papsttum nicht gelungen war, vollendete das Luthertum:<br />
es unterwarf den ganzen Menschen der religiösen Knechtschaft, es schuf den<br />
Dogmen-Menschen. Mit deutlichem Hinweis auf Stirner wird Valentin<br />
Weigel gerühmt, der Revolutionär; weniger Gnade finden Paracelsus und<br />
Böhme, aber sie werden durch den "Schund" entschuldigt, den sie an der<br />
Bibel vorfanden. Endlich schüttet der Verfasser die ganze Fülle seines<br />
Spottes darüber aus, daß das Luthertum alle Unionsbestrebungen von sich<br />
wies, den sogenannten Synkretismus; "diese Friedensvorschläge, welche<br />
auf nichts anderes ausgingen als die Theologen ihrer dogmatischen Kraftäußerungen,<br />
ja ihrer Kraft selber zu berauben, mußten den heftigsten<br />
Widerspruch der rein Lutherischen erfahren . . . Ganz richtig: denn die<br />
Calvinisten und Papisten, indem sie zu den Lutherischen im Gegensatz<br />
standen, erkannten doch wenigstens das Luthertum als eine Existenz an.<br />
Hier aber wurde es für eine Nebensache erklärt."<br />
Knoblauch gewesen sein soll. Streitschriften gegen das Übernatürliche, gegen das Wunder.<br />
Die Zeugen eines Wunders seien immer unglaubwürdig; "es ist noch immer unendlich<br />
wahrscheinlicher, daß zwei, drei, vier, daß fünfzig, daß tausend Menschen gelogen oder sich<br />
geirrt haben, als daß ein Wunder geschehen ist." — "Die größten Theologen gestehen selbst,<br />
daß, wenn ein für göttlich ausgegebenes Buch auch nur einen einzigen erweislichen Irrtum<br />
oder Unwahrheit enthält, dieses Buch nicht als eine authentische Offenbarung angenommen<br />
werden kann." — „Man wird zugeben müssen, daß es Millionen Lügner und Irrende gegen<br />
einen Auferstandenen gibt ... in zweifelhaften Fällen ist die Vermutung für das Wahrscheinlichere."<br />
— "Ein notwendiges Wesen kann kein Wunder tun." — "Entweder Alles<br />
oder Nichts ist Wunder."<br />
La Rochefoucauld 209<br />
Nun wäre es an der Zeit, daß die Junghegelianer dem stärksten und<br />
übermütigsten Hegelianer Platz machten, Stirner, dem Einzigen; aber ich<br />
habe mir vorgenommen, zuvor noch — mit wenigen Worten — einen<br />
viel älteren, einen französischen Eigenen zur Vergleichung aufzurufen.<br />
Ich habe schon auf den Wesensunterschied zwischen Stirners Tat und<br />
der dünnen Aufklärung des 18. Jahrhunderts hingewiesen, deren verhegelter<br />
Vertreter eben Feuerbach war. Da scheint es mir gut, an dieser Stelle<br />
— bevor ich endlich Stirner selbst zu Wort kommen lasse — des Mannes<br />
aus dem 17. Jahrhundert zu gedenken, den ich bisher nur flüchtig erwähnt<br />
habe und den ich in der Geschichte des neuen Frankreich nur auf die Gefahr<br />
hin hätte behandeln können, den Rahmen jenes Abschnittes zu zerreißen.<br />
Ich meine den Herzog de la Rochefoucauld (geb. 1613, gest. 1680), der kein<br />
berufsmäßiger Denker oder gar Freidenker war, der aber die Umwertung<br />
aller moralischen Begriffe, die moralische Revolution eines Stirner und eines<br />
Nietzsche dazu, schon hätte vollziehen müssen, wenn er den Ehrgeiz gehabt<br />
hätte, seine eigenen Maximen zu Ende zu denken. Diese Maximen (außer<br />
einem Geschichtswerke das einzige Buch, das der vornehme Herr zu schreiben<br />
geruhte) konnten alle Franzosen auswendig, wie Voltaire einmal sagte.<br />
Sie wurden aber nur oberflächlich eingeschätzt als fein geschliffene Aphorismen,<br />
als virtuose Variationen über ein einziges Motiv, das des Egoismus.<br />
Und nicht ganz mit Unrecht war dieser gründlichste Materialist der Moral<br />
nicht zu den Befreiern der Menschheit gerechnet worden. Es ist ja doch ein<br />
ander Ding, ob ein Stirner und bald nach ihm ein Nietzsche mit Aufbietung<br />
aller Seelenkräfte die Geltung ererbter Ideale und Abstraktionen im<br />
Namen der Wahrhaftigkeit zu annihilieren suchen, oder ob ein müßiger<br />
Herzog von Frankreich diese Ideale und Abstraktionen für seine Person<br />
als ein Nichts achtet, weil er sie in seinem Erbe nicht vorgefunden hat.<br />
Der Ruhm eines Meisters des Aphorismus wird ihm bleiben; nicht einmal<br />
Nietzsche hat die mustergültige Form immer so restlos erreicht. Er war wie<br />
Stirner der Einzige, in seinem Egoismus ohne Nebenmenschen, ohne<br />
Hemmung; er hätte wie Stirner rufen können, er habe seine Sach' auf sich<br />
gestellt oder auf nichts; aber er war sich seiner Einzigkeit nicht bewußt, wie<br />
Stirner sich dessen bewußt war. So wurde la Rochefoucauld mit all seinem<br />
Hohngelächter über die Tugendlüge, über die Mitleidlüge, über die Opferlüge<br />
usw. kein Befreier. Er war nur selbst frei. Wie ein Verbrecher frei<br />
ist, der zufällig als ein großer Herr geboren wurde. Was ich nicht falsch<br />
verstanden wissen möchte; auch ich schätze den praktischen Moralkritiker sehr<br />
hoch ein, der z.B. eingestanden bat: "Dans l'adversité de nos meilleurs<br />
amis nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous déplaît pas."<br />
Aber das spöttische Lachen La Rochefoucaulds reicht doch höchstens an