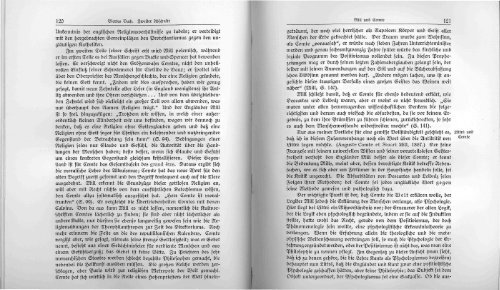Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
120 Viertes Buch. Zweiter Abschnitt<br />
Unkenntnis der englischen Religionsverhältnisse zu tadeln; er verteidigt<br />
mit den hergebrachten Gemeinplätzen den Protestantismus gegen den ungläubigen<br />
Katholiken.<br />
Im zweiten Teile seiner Schrift erst wird Mill polemisch, während<br />
er im ersten Teile es bei Ausfällen gegen Buckle und Spencer hat bewenden<br />
lassen. Er verschweigt nicht den Größenwahn Comtes, nicht den unheilvollen<br />
Einfluß seiner Schwärmerei für Clotilde de Vaux; er spottet leise<br />
über den Oberpriester des Menschengeschlechts, der eine Religion gründete,<br />
die keinen Gott kennt. "Indem wir dies aussprechen, haben wir genug<br />
gesagt, damit neun Zehnteile aller Leser (in England wenigstens) ihr Antlitz<br />
abwenden und ihre Ohren verschließen . . . Und von dem übrigbleibenden<br />
Zehntel wird sich vielleicht ein großer Teil von allem abwenden, was<br />
nur überhaupt den Namen Religion trägt." Und der Engländer Mill<br />
ist so frei, hinzuzufügen: "Trotzdem wir wissen, in welch einer außerordentlich<br />
kleinen Minderheit wir uns befinden, wagen wir dennoch zu<br />
denken, daß es eine Religion ohne Gottesglauben geben und daß eine<br />
Religion ohne Gott sogar für Christen ein belehrender und nutzbringender<br />
Gegenstand der Betrachtung sein kann" (S. 94). Bedingungen einer<br />
Religion seien nur Glaube und Gefühl, die Autorität über die Handlungen<br />
der Menschen haben; desto besser, wenn sich Glaube und Gefühl<br />
um einen konkreten Gegenstand gleichsam kristallisieren. Dieser Gegenstand<br />
ist für Comte das Gesamtdasein des grand être. Daraus ergibt sich<br />
die moralische Lehre des Altruismus; Comte hat das neue Wort für den<br />
alten Begriff zuerst geformt und den Begriff konsequent auch auf die Tiere<br />
ausgedehnt. Mill erkennt die Grundzüge dieser gottlosen Religion an,<br />
will aber mit Recht nichts von dem ausführlichen Katechismus wissen,<br />
den Comte allzu systematisch ausgeführt hat. "Herr Comte ist moraltrunken"<br />
(S. 99). Er vergleicht die Übertriebenheiten Comtes mit denen<br />
Calvins. Von da aus kann Mill es nicht lassen, namentlich die Kultvorschriften<br />
Comtes lächerlich zu finden; sie sind aber nicht lächerlicher als<br />
andere Kulte, nur dürften sie ebenso langweilig gewesen sein wie die Religionsübungen<br />
der Theophilanthropen zur Zeit des Direktoriums. Noch<br />
mehr erinnern die Feste an die des republikanischen Kalenders. Comte<br />
vergißt aber, wie gesagt, niemals seine strenge Gottlosigkeit; was er Gebet<br />
nennt, besteht aus einer Gedächtnisfeier für verdiente Menschen und aus<br />
einem Gefühlserguß; das Gebet ist keine Bitte. Zu Priestern des sehr<br />
monarchischen Staates werden schlecht bezahlte Philosophen gemacht, die<br />
nebenbei die Heilkunst ausüben müssen. Die großen Reiche werden zerschlagen,<br />
aber Paris wird zur religiösen Metropole der Welt gemacht.<br />
Comte hat sich wirklich in die Rolle eines Hohenpriesters der Welt hinein<br />
Mill und Comte 121<br />
geträumt, der noch viel herrischer als Napoleon Körper und Geist aller<br />
Menschen der Erde geknechtet hätte. Der Traum wurde zum Wahnsinn,<br />
als Comte "voraussah", er würde nach sieben Jahren Unterrichtsminister<br />
werden und genau sechsundzwanzig Jahre später würde das kirchliche und<br />
soziale Programm des Positivismus vollendet sein. Zu diesen Prophezeiungen<br />
mag er durch seinen letzten Zahlenaberglauben gelangt sein, der<br />
leider mit seinen Anwendungen auf den Stil und auf die Bücherabfassung<br />
schon Blödsinn genannt werden darf. „Andere mögen lachen, uns ist angesichts<br />
dieses traurigen Verfalls eines großen Geistes das Weinen weit<br />
näher" (Mill, S. 140).<br />
Mill schließt damit, daß er Comte für ebenso bedeutend erklärt, wie<br />
Descartes und Leibniz waren, aber er meint es nicht freundlich. "Sie<br />
waren unter allen hervorragenden wissenschaftlichen Denkern die folgerichtigsten<br />
und darum auch vielfach die absurdesten, da sie vor keinem Ergebnis,<br />
zu dem ihre Prämissen zu führen schienen, zurückschreckten, so sehr<br />
es auch dem Menschenverstande widerstreiten mochte" (S. 141).<br />
Nur aus meiner Vorliebe für eine gewisse Vollständigkeit geschieht es, Littré und<br />
daß ich in diesem Zusammenhange noch ein Wort über die Antikritik von<br />
Littré sagen möchte. (Auguste Comte et Stuart Mill, 1867.) Der feine<br />
Franzose mit seinem universellen Wissen und seiner vorurteilslosen Geistesfreiheit<br />
versteht den Engländer Mill besser als dieser Comte; er kennt<br />
die Bedeutung Mills, meint aber, dessen berechtigte Kritik betreffe Nebensachen,<br />
wo es sich aber um Irrtümer in der Hauptsache handeln solle, sei<br />
die Kritik ungerecht. Die Absurditäten von Descartes und Leibniz seien<br />
Folgen ihrer Methoden; bei Comte sei jedes unglückliche Wort gegen<br />
seine Methode gewesen und pathologisch dazu.<br />
Der wichtigste Punkt ist der, daß Comte die Welt erklären wolle, der<br />
Logiker Mill jedoch die Erklärung des Menschen verlange, also Psychologie.<br />
Hier liegt bei Littré ein Mißverständnis vor; der Erneuerer der alten Logik,<br />
der die Logik eben psychologisch begründete, indem er sie auf die Induktion<br />
stellte, hatte wohl das Recht, gerade von dem Positivismus, der doch<br />
Phänomenologie sein wollte, eine psychologistische Erkenntnistheorie zu<br />
verlangen. Wenn die Erfahrung allein die theologische und die metaphysische<br />
Weltanschauung verdrängen soll, so muß die Psychologie der Erfahrung<br />
ergründet werden, oder der Positivismus ist nicht das, was man eine<br />
Philosophie zu nennen pflegt. Im Gegensatz zu dieser Ansicht (man sieht,<br />
daß ich zu denen gehöre, die die Lehre Kants als Psychologismus begreifen)<br />
behauptet nun Littré, daß die Engländer und Kant zwar eine positivistische<br />
Psychologie geschaffen hätten, aber keine Philosophie; das Subjekt sei dem<br />
Objekt untergeordnet, der Psychologismus sei eine Sackgasse. Ob die aus