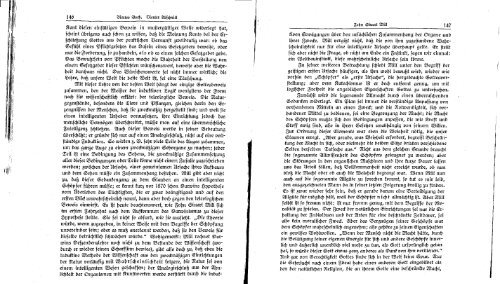Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
146 Viertes Buch. Vierter Abschnitt<br />
Kant diesen einfältigen Beweis in mustergültiger Weise widerlegt hat,<br />
scheint übrigens auch schon zu wissen, daß die Meinung Kants bei der Erschließung<br />
Gottes aus der praktischen Vernunft zweideutig war: ob das<br />
Gefühl eines Pflichtgesetzes das Dasein eines Gesetzgebers beweise, oder<br />
nur die Forderung, so zu handeln, als ob es einen solchen Gesetzgeber gebe.<br />
Das Bewußtsein von Pflichten mache die Wahrheit der Vorstellung von<br />
einem Gesetzgeber dieser Pflichten wünschenswert, beweise aber die Wahrheit<br />
durchaus nicht. Das Wünschenswerte sei nicht immer wirklich; die<br />
Lehre, daß unsere Welt die beste Welt ist, sei eine Täuschung.<br />
Mit dieser Lehre von der besten Welt hängt der einzige Gottesbeweis<br />
zusammen, den der Meister der induktiven Logik wenigstens der Form<br />
nach für wissenschaftlich erklärt: der teleologische Beweis. Die Naturgegenstände,<br />
besonders die Tiere und Pflanzen, gleichen darin den Erzeugnissen<br />
der Menschen, daß sie zweckmäßig hergestellt sind; und weil sie<br />
einen intelligenten Urheber voraussetzen, ihre Einrichtung jedoch das<br />
menschliche Vermögen überschreitet, müsse man auf eine übermenschliche<br />
Intelligenz schließen. Auch dieser Beweis werde in seiner Bedeutung<br />
überschätzt; er gründe sich nur auf einen Analogieschluß, nicht auf eine vollständige<br />
Induktion. So wirken z. B. sehr viele Teile des Auges zusammen,<br />
um das ganze Auge zu einem zweckmäßigen Sehorgane zu machen; jeder<br />
Teil ist eine Bedingung des Sehens, die zweckmäßige Zusammensetzung<br />
aller dieser Bedingungen oder Teile könne nicht einem Zufalle zugeschrieben<br />
werden; zwischen der Ursache, einer gemeinsamen Ursache ihres Aufbaues<br />
und dem Sehen müsse ein Zusammenhang bestehen. Mill gibt aber nicht<br />
zu, daß dieser Gedankengang zu dem Glauben an einen intelligenten<br />
Schöpfer führen müsse; er kennt kurz vor 1870 schon Darwins Hypothese<br />
vom Überleben des Tüchtigsten, die er zwar beängstigend und auf den<br />
ersten Blick unwahrscheinlich nennt, dann aber doch gegen den teleologischen<br />
Beweis einwirft. Es ist heute beachtenswert, wie John Stuart Mill sich<br />
im ersten Jahrzehnt nach dem Aufkommen des Darwinismus zu dieser<br />
Hypothese stellte. Sie sei nicht so absurd, wie sie aussieht. „Die Theorie<br />
würde, wenn zugegeben, in keiner Weise mit dem Begriffe der Schöpfung<br />
unvereinbar sein; aber es muß anerkannt werden, daß sie den Beweis für<br />
dieselbe beträchtlich schwächen würde." Wohlgemerkt: Mill rechnet Darwins<br />
Deszendenzlehre noch nicht zu dem Bestande der Wissenschaft (wodurch<br />
er wieder seinen Scharfsinn bewies), gibt also doch zu, daß eben die<br />
induktive Methode der Wissenschaft aus den zweckmäßigen Einrichtungen<br />
der Natur vorläufig mit Wahrscheinlichkeit folgere, die Natur sei von<br />
einem intelligenten Wesen geschaffen; der Analogieschluß aus der Ähnlichkeit<br />
der Organismen mit Kunstwerken werde verstärkt durch die induk-<br />
John Stuart Mill 147<br />
tiven Erwägungen über den ursächlichen Zusammenhang der Organe und<br />
ihrer Zwecke. Mill vergißt nicht, daß die von ihm zugestandene Wahrscheinlichkeit<br />
nur für eine intelligente Ursache überhaupt gelte. Er stellt<br />
sich aber nicht die Frage, ob nicht am Ende ein Instinkt, sagen wir einmal:<br />
ein Weltbauinstinkt, diese wahrscheinliche Ursache sein könne.<br />
|n seiner weiteren Betrachtung schiebt Mill unter den Begriff der<br />
geistigen ersten Ursache häufiger, als ihm wohl bewußt wird, wieder wie<br />
vorhin den „Schöpfer" als "erste Ursache", die hergebrachte Gottesvorstellung;<br />
aber vom Katechismus ist er doch entfernt genug, um mit<br />
logischer Freiheit die angeblichen Eigenschaften Gottes zu untersuchen.<br />
Zunächst wird die sogenannte Allmacht durch einen überraschenden<br />
Gedanken widerlegt. Ein Plan sei immer die verständige Anpassung von<br />
vorhandenen Mitteln an einen Zweck; und die Notwendigkeit, sich vorhandener<br />
Mittel zu bedienen, sei eine Begrenzung der Macht; die Macht<br />
des Schöpfers mußte sich den Bedingungen anpassen, die wie Kraft und<br />
Stoff ewig sind, also in ihren Gesetzen unabhängig von seinem Willen.<br />
Zur Ordnung dieser Elemente war eben die Weisheit nötig, die unser<br />
Staunen erregt. "Aber gerade, was Weisheit erfordert, begreift Beschränkung<br />
der Macht in sich, oder vielmehr die beiden Sätze drücken verschiedene<br />
Seiten derselben Tatsache aus." Nicht aus dem gleichen Grunde braucht<br />
die sogenannte Allwissenheit des Schöpfers geleugnet zu werden; aber<br />
die Störungen in den organischen Maschinen und ihre kurze Dauer lassen<br />
uns das Urteil fallen, daß Vollkommenheit nicht erreicht wurde, ob nun<br />
bloß die Macht oder ob auch die Weisheit begrenzt war. Wenn Mill nun<br />
auch auf die sogenannte Allgüte zu sprechen kommt, so tut es mir leid,<br />
den ausgezeichneten Mann da in seiner letzten Folgerung drollig zu finden.<br />
Es ist zwar wieder sehr fein, daß er gerade darum eine Verteidigung der<br />
Allgüte für möglich hält, weil der Schöpfer nicht allmächtig ist. Aber Mill<br />
selbst ist so fromm nicht; ist nur fromm genug, mit dem Begriffe der Moralität<br />
zu spielen. Der Zweck der natürlichen Einrichtungen sei nur die Erhaltung<br />
der Individuen und der Arten für eine beschränkte Zeitdauer, sei<br />
also kein moralischer Zweck. Aber das Vergnügen seiner Geschöpfe war<br />
dem Schöpfer wahrscheinlich angenehm; also gehöre zu seinen Eigenschaften<br />
ein gewisses Wohlwollen. "Wenn der Mensch nicht die Macht hätte, durch<br />
die Betätigung seiner eigenen Energie für sich und andere Geschöpfe innerlich<br />
und äußerlich unendlich viel mehr zu tun, als Gott ursprünglich getan<br />
hat, so würde dieser Gott etwas ganz anderes als Dank von ihm verdienen."<br />
Und gar von Gerechtigkeit Gottes finde sich in der Welt keine Spur. Nur<br />
die Sehnsucht nach einem Ideal habe einen anderen Gott eingebildet als<br />
den der natürlichen Religion, die an ihrem Gotte eine beschränkte Macht,