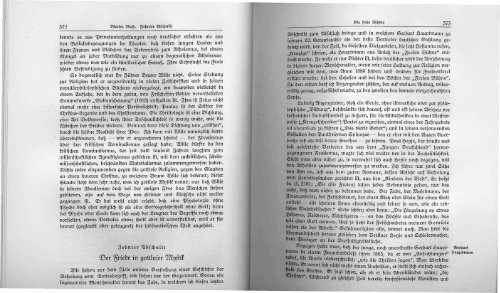Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
372 Viertes Buch. Zehnter Abschnitt<br />
konnte es aus Privatunterhaltungen noch deutlicher erfahren als aus<br />
den Beifallsbezeugungen im Theater, daß diesen jungen Leuten und<br />
ihren Frauen und Mädchen das Bekenntnis zum Atheismus, bei einem<br />
Mangel an jeder Vorbildung nur zu einem dogmatischen Atheismus,<br />
wieder etwas war wie ein künstlerischer Genuß. Ihre Sehnsucht ins Freie<br />
schien Befriedigung zu finden.<br />
So dogmatisch war ihr Führer Bruno Wille nicht. Seine Stellung<br />
zur Religion hat er unzweideutig in vielen Zeitschriften und in seinen<br />
populärphilosophischen Büchern niedergelegt, am knappsten vielleicht in<br />
einem Aufsatze, der in dem guten, von Frischeisen-Köhler veranstalteten<br />
Sammelwerke „Weltanschauung" (1910) enthalten ist. Ihm ist Jesus nicht<br />
einmal mehr eine historische Persönlichkeit; Paulus ist der Stifter der<br />
Christus-Legende und des Christentums. Die Christologie ist eine Dichtung,<br />
eine Art Volkspoesie; trotz ihrer Anschaulichkeit so wenig wahr, wie die<br />
Märchen der Brüder Grimm. Dennoch kann diese Dichtung uns „erlösen",<br />
durch die schöne Realität ihrer Idee. Ich kann mit Wille unmöglich darin<br />
übereinstimmen, daß — wie er anzunehmen scheint — der Idealismus<br />
über den kritischen Nominalismus gesiegt habe; Wille dürfte da den<br />
kritischen Nominalismus, der seit bald tausend Jahren langsam zum<br />
wissenschaftlichen Agnostizismus gediehen ist, mit dem unkritischen, scheinwissenschaftlichen,<br />
beschränkten Materialismus zusammengeworfen haben.<br />
Nichts wäre einzuwenden gegen die gottlose Religion, gegen den Glauben<br />
an einen inneren Christus, zu welchem Bruno Wille sich bekennt; dieser<br />
Glaube steht dem sehr nahe, was ich gottlose Mystik nenne; nur daß Wille<br />
in seinem Idealismus doch bei der ewigen Idee des Menschen stehen<br />
geblieben, also auf dem Wege von Stirner und Nietzsche nicht weiter<br />
gegangen ist. Er hat wohl nicht erlebt, daß eine Psychologie ohne<br />
Psyche doch eher möglich ist als eine Gottesgelahrtheit ohne Gott; denn<br />
bei Psyche oder Seele kann sich auch der Leugner des Begriffs noch etwas<br />
vorstellen, etwas Verbales etwa; Gott aber ist unvorstellbar, weil er für<br />
immer (geglaubt oder geleugnet) der substantivischen Welt angehört.<br />
Zehnter Abschnitt<br />
Der Friede in gottloser Mystik<br />
Wir stehen vor dem Ziele unserer Darstellung einer Geschichte der<br />
Befreiung vom Gottesbegriff, wir stehen vor der Gegenwart. Genau ein<br />
sogenanntes Menschenalter trennt das Jahr, in welchem ich diesen letzten<br />
Die freie Bühne 373<br />
Abschnitt zum Abschluß bringe und in welchem Gerhart Hauptmann zu<br />
seinem 60. Geburtsjahre als der beste Vertreter deutscher Dichtung gefeiert<br />
wird, von der Zeit, da dieselben Vielzuvielen, die jetzt Hosianna rufen,<br />
kreuzige" schrien, als Hauptmann aus Anlaß der „Freien Bühne" entdeckt<br />
wurde. Je mehr er nur Dichter ist, desto deutlicher wird der Umschwung<br />
in diesem kurzen Menschenalter, wenn wir seine Haltung zur Religion vergleichen<br />
mit dem, was Anno 1889 hüben und drüben für Freidenkerei<br />
erklärt wurde: bei den Schafen und bei den Böcken der „Freien Bühne".<br />
Zu den ersten darf ich Anzengruber zählen, der auf meinen Antrag, widerwillig<br />
genug, aufgeführt wurde, zu den zweiten den damals vielgeschmähten<br />
Heyse.<br />
Ludwig Anzengruber, bloß ein Genie, ohne literarische oder gar philosophische<br />
„Bildung", beschränkte sich darauf, oft und oft seinen Abscheu vor<br />
katholischer Unduldsamkeit zu äußern, für die Altkatholiken in einer Meisterposse<br />
(„Kreuzelschreiber") Partei zu ergreifen, einmal eines der Zehngebote<br />
ad absurdum zu führen („Das vierte Gebot") und in seinen versonnensten<br />
Gestalten den Pantheismus Spinozas — den er eher mit den Augen Auerbachs<br />
sah als mit denen Goethes — zu lehren. Paul Heyse, der feinste und<br />
fast gelehrteste Vertreter des aus dem "Jungen Deutschland" hervorgegangenen<br />
Realismus, wagte sich viel weiter vor in der Unchristlichkeit.<br />
Sieht man aber näher zu, so verwahrt sich auch Heyse noch dagegen, mit<br />
den Atheisten zusammengeworfen zu werden. Ich führe nur zwei Sätze<br />
von ihm an, just aus dem guten Romane, dessen Absicht auf Befreiung<br />
vom Jenseitsglauben gerichtet ist, aus den "Kindern der Welt". Es heißt<br />
da (I, 218): „Sie (die Freien) lassen jedes Bekenntnis gelten, nur das<br />
nicht, daß man nichts zu bekennen habe. Der Jude, der Muselmann, der<br />
Feueranbeter, der Fetischdiener, der einen Klotz oder Stein für einen Gott<br />
ansieht — alle scheinen ihnen ehrwürdig und keiner so arm, wie ein redlicher<br />
Wahrheitsucher." Sehr schön; aber dann: „Die Hingebung an etwas<br />
Höheres, Reicheres, Mächtigeres — an das Höchste und Erhabenste, das<br />
wir eben Gott nennen. Und so steht der Fetischanbeter meinem Gemüte<br />
näher als der Atheist." Gefühlsreligion also, immer noch. Man hört die<br />
Verwandtschaft heraus zwischen dem Berliner Heyse und Schleiermacher,<br />
dem Prediger an der Dreifaltigkeitskirche.<br />
Dagegen halte man, daß der junge, noch unentdeckte Gerhart Haupt Gerhart<br />
mann in einem Freundesbriefe schon 1883, da er von "Anfechtungen"<br />
redet, die Worte niederschreibt: "wie die Christen sagen". Man überhöre<br />
nichts. Er nennt sich nicht mehr einen Unchristen, er stellt sich einfach außerhalb<br />
des Kreises. Er sagt schon, als ob er kein Abendländer wäre: "die<br />
Christen". Während zu gleicher Zeit bereits konfessionslose Monisten und