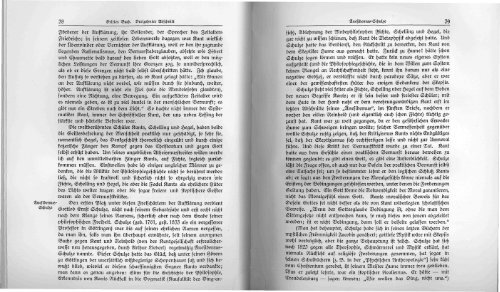Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
38 Drittes Buch. Dreizehnter Abschnitt<br />
Förderer der Aufklärung, ihr Vollender, der Sprecher des Zeitalters<br />
Friedrichs; in seinem zeitlosen Lebenswerke dagegen war Kant wirklich<br />
der Überwinder oder Vernichter der Aufklärung, weil er den ihr zugrunde<br />
liegenden Rationalismus, den Vernunftaberglauben, absetzte wie Hébert<br />
und Chaumette bald darauf den lieben Gott absetzten, weil er den möglichen<br />
Leistungen der Vernunft ihre Grenzen zog, so unwidersprechlich,<br />
als ob er diese Grenzen nicht bald selbst überschritten hätte. Ich glaube,<br />
den Aufsatz so verstehen zu dürfen, als ob Kant gesagt hätte: "Wir können<br />
an der Aufklärung nicht vorbei, wir müssen durch sie hindurch, weiter,<br />
höher. Aufklärung ist nicht ein Ziel (wie die Mendelssohn glaubten),<br />
sondern eine Richtung, eine Bewegung. Ein aufgeklärtes Zeitalter wird<br />
es niemals geben, es ist zu viel dunkel in der menschlichen Vernunft; es<br />
gibt nur ein Streben nach dem Licht." So dachte nicht immer der Systematiker<br />
Kant, immer der Schriftsteller Kant, der uns neben Lessing der<br />
stärkste und härteste Befreier war.<br />
Die weltberühmten Schüler Kants, Schelling und Hegel, haben beide<br />
die Geistesbefreiung der Menschheit praktisch nur geschädigt, so sehr sie,<br />
namentlich Hegel, das Denkgeschäft theoretisch eingeübt und durch einige<br />
ketzerische Jünger den Kampf gegen das Christentum und gegen Gott<br />
selbst erhitzt haben. Um seines angeblichen Atheismusstreites willen werde<br />
ich auf den unmittelbarsten Jünger Kants, auf Fichte, sogleich zurückkommen<br />
müssen. Einstweilen habe ich einiger ungleicher Männer zu gedenken,<br />
die die Willkür der Philosophiegeschichte nicht so berühmt werden<br />
ließ, die nicht so kraftvoll und sicherlich nicht so ehrgeizig waren wie<br />
Fichte, Schelling und Hegel, die aber die Fackel Kants als ehrlichere Hüter<br />
des Lichts weiter trugen oder die sogar freiere und skeptischere Geister<br />
waren als der Vernunftkritiker.<br />
Den ersten Platz unter diesen Freischärlern der Aufklärung verdient<br />
Gottlob Ernst Schulze, nicht nach seinem Geburtsjahr und erst recht nicht<br />
nach dem Klange seines Namens, sicherlich aber nach dem Grade seiner<br />
philosophischen Freiheit. Schulze (geb. 1761, gest. 1833 als ein vergessener<br />
Professor in Göttingen) war bis auf seinen ehrlichen Namen vergessen,<br />
da man ihn, falls man ihn überhaupt erwähnte, seit seinem anonymen<br />
Buche gegen Kant und Reinhold (von der Kantgesellschaft erfreulicherweise<br />
neu herausgegeben, durch Arthur Liebert) regelmäßig Änesidemus-<br />
Schulze nannte. Dieser Schulze hatte das Glück, daß unter seinen Hörern<br />
zu Göttingen der unersättlich wißbegierige Schopenhauer saß und sich bewußt<br />
blieb, wieviel er diesem scharfsinnigsten Gegner Kants verdankte;<br />
man kann es genau angeben: Sinn für die Geschichte der Philosophie,<br />
Erkenntnis von Kants Rückfall in die Dogmatik (Kausalität des Ding-an-<br />
Änesidemus-Schulze 39<br />
sich), Ablehnung der Modephilosophen Fichte, Schelling und Hegel, die<br />
gar nicht zu wissen schienen, daß Kant die Metaphysik abgesetzt hatte. Und<br />
Schulze hatte das Verdienst, den Rückschritt zu bemerken, den Kant von<br />
dem Skeptiker Hume aus gemacht hatte. Zurück zu Hume! hätte schon<br />
Schulze sagen können und müssen. Er hatte kein neues eigenes System<br />
aufgestellt (und die Philosophiegeschichte, die in dem Willen zum System<br />
keinen Mangel an Rechtschaffenheit sieht, kennt ihn darum nur als eine<br />
negative Größe), er verblüffte nicht durch paradoxe Sätze, aber er war<br />
einer der gewissenhaftesten Hüter des ewigen Gedankens der Skepsis.<br />
Schulze steht viel fester als Fichte, Schelling oder Hegel auf dem Boden<br />
der neuen Begriffe Kants; er ist sein bester und freiester Schüler; mit<br />
dem Hute in der Hand naht er dem verehrungswürdigen Kant erst im<br />
letzten Abschnitte seines „Änesidemus", im fünften Briefe, nachdem er<br />
vorher den eitlen Reinhold (und eigentlich auch schon Fichte) tüchtig gezaust<br />
hat. Kant war zu weit gegangen, da er den gefährlichen Erwecker<br />
Hume zum Schweigen bringen wollte; solcher Vermessenheit gegenüber<br />
wollte Schulze ruhig zeigen, daß der Kritizismus Kants nichts Endgültiges<br />
sei, daß der Skeptizismus sich rechtfertigen lasse und nicht zur Unmoral<br />
führe. Und diese Kritik der Vernunftkritik wurde zu einer Tat. Kant<br />
hatte aus dem Gefühle einer praktischen Vernunft heraus beweisen zu<br />
können geglaubt: es gibt einen Gott, es gibt eine Unsterblichkeit. Schulze<br />
läßt die Frage offen, ob auch nur das Dasein der praktischen Vernunft selbst<br />
eine Tatsache sei; um so bestimmter lehnt er den logischen Schluß Kants<br />
ab; er sagt: aus den Forderungen des Moralgefühls könne niemals auf die<br />
Existenz der Bedingungen geschlossen werden, unter denen die Forderungen<br />
Geltung haben. Ein Gott könne die Notwendigkeit der Moral garantieren,<br />
nicht das Moralgefühl einen Gott. Kants moralischer Beweis für das<br />
Dasein Gottes sei nicht besser als die von Kant widerlegten scholastischen<br />
Beweise. "Wenn der Gottesglaube Bedingung ist, ohne die man dem<br />
Sittengesetze nicht entsprechen kann, so muß dieses von jenem abgeleitet<br />
werden; ist er nicht Bedingung, dann soll er beiseite gelassen werden."<br />
(Man hat behauptet, Schulze habe sich in seinen letzten Büchern der<br />
mystischen Frömmigkeit Jacobis genähert; gottlose Mystik wäre mit Skepsis<br />
wohl verträglich, aber die ganze Behauptung ist falsch. Schulze hat sich<br />
noch 1823 gegen alle Theosophie, Schwärmerei und Mystik erklärt, hat<br />
niemals Rücksicht auf religiöse Forderungen genommen, hat sogar in<br />
seinen Schulbüchern [z. B. in der "Psychischen Anthropologie"] sehr kühl<br />
vom Christentum geredet, ist seinem Meister Hume immer treu geblieben.<br />
Was er zuletzt lehrte, war ein skeptischer Realismus. Er hätte — mit<br />
Trendelenburg — sagen können: "Wir wollen das Ding, nicht uns.")