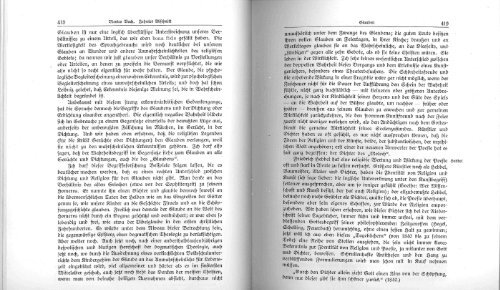Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
418<br />
Viertes Buch. Zehnter Abschnitt<br />
Glauben ist nur eine logisch überflüssige Unterstreichung unseres Verhältnisses<br />
zu einem Urteil, das wir eben bona fide gefällt haben. Die<br />
Wertlosigkeit des Sprachgebrauchs wird noch deutlicher bei unserem<br />
Glauben an Wunder und andere Unwahrscheinlichkeiten des religiösen<br />
Gebiets; da nennen wir just glauben unser Verhältnis zu Vorstellungen<br />
oder Urteilen, an denen zu zweifeln die Vernunft verpflichtet, die wir<br />
also nicht so recht eigentlich für wahr halten. Der Glaube, die psychologische<br />
Begleiterscheinung einer wahren Erkenntnis, wird zur psychologischen<br />
Begleiterscheinung eines unwahrscheinlichen Urteils; und doch hat schon<br />
Leibniz gelehrt, daß Erkenntnis diejenige Meinung sei, die in Wahrscheinlichkeit<br />
begründet ist.<br />
Unbekannt mit diesem streng erkenntniskritischen Gedankengange,<br />
hat die Sprache dennoch die Begriffe des Glaubens und der Dichtung oder<br />
Erdichtung einander angenähert. Die eigentlich negative Wahrheit bildete<br />
sich im Gebrauche zu einem Gegensatze einerseits der bewußten Lüge aus,<br />
anderseits der unbewußten Fälschung im Märchen, im Gerücht, in der<br />
Dichtung. Und wir haben eben erfahren, daß die religiösen Legenden<br />
(für die Kritik Gerüchte oder Dichtungen) den Glauben verlangen, weil<br />
sie nicht zu den wahrscheinlichen Erkenntnissen gehören. Ich darf also<br />
sagen, daß der Wahrheitsbegriff im Gegensatze stehe zum Glauben an alle<br />
Gerüchte und Dichtungen, auch die des "Glaubens".<br />
Ich darf dieser Begriffsforschung Beispiele folgen lassen, die es<br />
deutlicher machen werden, daß es einen rechten Unterschied zwischen<br />
Dichtung und Religion für den Glauben nicht gibt. Man denke an das<br />
Verhältnis des alten Griechen (etwa vor der Sophistenzeit) zu seinem<br />
Homeros. Er nannte ihn einen Dichter und glaubte dennoch sowohl an<br />
die übermenschlichen Taten der Helden wie an das Eingreifen der Götter<br />
genau so, wie unsere Kinder an die Geschichte Israels und an die Schöpfungsgeschichte<br />
glauben. Freilich war damals der Glaube an die Welt des<br />
Homeros nicht durch ein Dogma geschützt und verknöchert; er war eben so<br />
lebendig und frei, wie etwa der Bibelglaube in den ersten christlichen<br />
Jahrhunderten. Es würde unter dem Niveau dieser Betrachtung sein,<br />
die gegenwärtige Existenz einer dogmatischen Theologie zu berücksichtigen.<br />
Aber weiter noch. Auch jetzt noch, nach einer anderthalbtausendjährigen<br />
despotischen und blutigen Herrschaft der dogmatischen Theologie, auch<br />
jetzt noch, wo durch die Ausdehnung eines verkirchlichten Volksschulunterrichts<br />
dem Kindergehirn der Glaube an das Unwahrscheinliche für Lebenszeit<br />
eingebläut wird, viel allgemeiner und härter als es im finstersten<br />
Mittelalter geschah, auch jetzt noch steht das Denken der meisten Christen,<br />
wenn man von beinahe heiligen Ausnahmen absieht, durchaus nicht<br />
Glauben 419<br />
unaufhörlich unter dem Zwange des Glaubens; die guten Leute besitzen<br />
ihren vollen Glauben an Feiertagen, in ihrer Kirche; draußen und an<br />
Werkeltagen glauben sie an das Wahrscheinliche, an das Diesseits, und<br />
"sündigen" gegen alle zehn Gebote, als ob sie keine Christen wären. Sie<br />
leben in der Wirklichkeit. Ich sehe keinen wesentlichen Unterschied zwischen<br />
der doppelten Wahrheit dieses Vorgangs und dem Erlebnisse eines Kunstgenießers,<br />
besonders eines Theaterbesuchers. Die Schönheitsfreude und<br />
die erhebende Wirkung in einer Tragödie wäre gar nicht möglich, wenn der<br />
Zuschauer nicht für die Dauer der Aufführung den Schein der Wahrheit<br />
fühlte, nicht ganz buchstäblich — mit kleineren oder größeren Unterbrechungen,<br />
je nach der Kindlichkeit seines Herzens und der Güte des Spiels<br />
— an die Wahrheit auf der Bühne glaubte, um nachher — früher oder<br />
später — draußen aus seinem Glauben zu erwachen und zur gemeinen<br />
Wirklichkeit zurückzukehren, die den frommen Kunstfreund nach der Feier<br />
zuerst nicht weniger verletzen wird, als den Andächtigen nach dem Gottesdienst<br />
die gemeine Wirklichkeit seines Seelenzustandes. Künstler und<br />
Dichter haben es oft gefühlt, es nur nicht aussprechen können, daß die<br />
Ideen der Religion und der Künste, beide, der substantivischen, der mythischen<br />
Welt angehören; erst einer der neueren Umwerter der Poesie hat es<br />
fast ganz begriffen: der Dichter des „Moloch".<br />
Friedrich Hebbel hat eine religiöse Wertung und Wirkung der Poesie Hebbel<br />
oft und stark in Worte zu fassen versucht. Größere Künstler noch als Hebbel,<br />
Baumeister, Maler und Dichter, haben die Identität von Religion und<br />
Kunst (ich sage lieber: die logische Unterordnung unter den Kunstbegriff)<br />
seltener ausgesprochen, aber um so inniger gefühlt (Goethe: Wer Wissenschaft<br />
und Kunst besitzt, der hat auch Religion); der allzubewußte Hebbel,<br />
beinahe noch mehr Grübler als Dichter, quälte sich ab, die Poesie überhaupt,<br />
besonders aber sein eigenes Schaffen, zur Würde der Religion emporzuheben.<br />
Wir haben schon erfahren, wie dieser Dichter sich bei der Niederschrift<br />
seiner Tagebücher, immer kühn und immer unfrei, mit dem verblassenden<br />
Gottesbegriff seiner philosophierenden Zeitgenossen (Hegel,<br />
Schelling, Feuerbach) herumschlug, ohne einen festen Halt zu gewinnen;<br />
jetzt will ich aus eben diesen "Tagebüchern" (von 1840 bis zu seinem<br />
Tode) eine Reihe von Stellen ausziehen, die sein nicht immer klares<br />
Bekenntnis zur Identität von Religion und Poesie, ja mitunter von Gott<br />
und Dichter, beweisen. Schrullenhafte Antithesen und den Hang zu<br />
verblüffenden Formulierungen wird man schon mit in Kauf nehmen<br />
müssen.<br />
„Durch den Dichter allein zieht Gott einen Zins von der Schöpfung,<br />
denn nur dieser gibt sie ihm schöner zurück." (1840.)