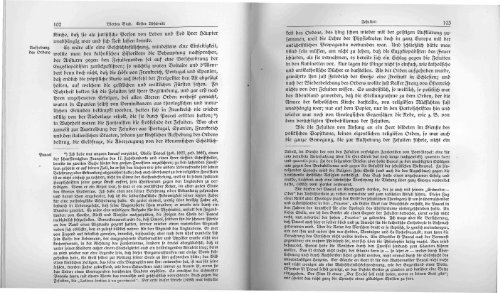Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
102<br />
Viertes Buch. Erster Abschnitt<br />
Kirche, daß sie als juristische Person von Leben und Tod ihrer Häupter<br />
unabhängig war und sich Zeit lassen konnte.<br />
Aufhebung Es wäre also eine Geschichtsfälschung, mindestens eine Einseitigkeit,<br />
des Ordens wollte man den katholischen Historikern die Behauptung nachsprechen,<br />
der Ansturm gegen den Jesuitenorden sei auf eine Verschwörung der<br />
Enzyklopädisten zurückzuführen; so mächtig waren Voltaire und d'Alembert<br />
denn doch nicht, daß die Höfe von Frankreich, Portugal und Spanien,<br />
daß endlich die päpstliche Kurie auf Befehl der Freigeister den Ast abgesägt<br />
hätten, auf welchem die geistlichen und weltlichen Fürsten saßen. In<br />
Wahrheit hatten sich die Jesuiten seit ihrer Begründung, und gar erst nach<br />
ihren ungeheueren Erfolgen, bei allen älteren Orden verhaßt gemacht,<br />
waren in Spanien selbst von Dominikanern aus theologischen und moralischen<br />
Gründen bekämpft worden, hatten sich in Frankreich nie wieder<br />
völlig von der Niederlage erholt, die sie durch Pascal erlitten hatten;*)<br />
in Wahrheit waren die Jansenisten die Todfeinde der Jesuiten. Was aber<br />
zumeist zur Austreibung der Jesuiten aus Portugal, Spanien, Frankreich<br />
und den italienischen Staaten, sodann zur kirchlichen Aufhebung des Ordens<br />
beitrug, die Geldfrage, die Überzeugung von der ökonomischen Schädlich<br />
Pascal *) Ich habe nur ungern darauf verzichtet, Blaise Pascal (geb. 1623, gest. 1662), einen<br />
der scharfsinnigsten Franzosen des 17. Jahrhunderts und einen ihrer tiefsten Schriftsteller,<br />
bereits im zweiten Buche hinter den großen Zweiflern anzuführen; zu den lachenden Zweiflern<br />
gehörte er auf keinen Fall, da er sich das Lachen wie jede andere Lebensfreude seit seiner<br />
Bekehrung oder Erkrankung abgewöhnt hatte; doch auch überhaupt zu den religiösen Zweiflern<br />
ist er nicht einfach zu rechnen, nicht im Sinne der Geistesbefreiung, weil er in seinen späteren<br />
Hauptschriften seine ganze Kraft aufbot, sein Christentum gegen den Unglauben zu verteidigen.<br />
Wenn er ein Ketzer war, so war er ein pietistischer Ketzer, im alten guten Sinne<br />
des Wortes Pietismus. Ich habe eben von seiner Bekehrung oder Erkrankung gesprochen<br />
und damit schon angedeutet, daß ich die leidenschaftliche Frömmigkeit seiner letzten Jahre<br />
für eine pathologische Erscheinung halte. Er geriet einmal, wenig über dreißig Jahre alt,<br />
dadurch in Lebensgefahr, daß seine Wagenpferde scheu wurden; er wurde wie durch ein<br />
Wunder gerettet. Es wäre eine würdigere Aufgabe für die Psychiatrie, anstatt den Jugendsünden<br />
von Goethe, Kleist und Nietzsche nachzuspüren, die Folgen des Choks bei Pascal<br />
medizinisch festzustellen. Bemerkenswert wäre da, daß Pascal, seitdem ihn die scheuen Pferde<br />
an den Rand eines Abgrunds gezerrt hatten, immer wieder einen materiellen Abgrund<br />
neben sich erblickte, den er zuletzt bildlich nahm: für den Abgrund des Unglaubens. Er war<br />
von Jugend auf kränklich gewesen, innerlich, beschaulich; aber nach dem Chok wandelte sich<br />
sein Geist: der Lebemann, der ausgezeichnete Mathematiker und Physiker wurde nicht nur<br />
kirchenfromm, in der Richtung des Jansenismus, sondern so brutal abergläubisch, daß er<br />
unter seinen Kleidern außer einem Stachelgürtel auch ein heilbringendes Amulett trug; denn<br />
es wird wieder nur eine Legende sein, daß dieser Pergamentstreifen nur einige Worte festgehalten<br />
habe, die Gott selber zur Rettung seiner Seele zu ihm gesprochen hätte; das Bild<br />
eines kindlichen Heiligen, das seine erste Biographin von ihm entworfen hat, ist nur für seine<br />
letzten, kranken Jahre zutreffend, wie denn Schwestern nicht immer zu trauen ist, wenn sie<br />
das Leben eines überragenden berühmten Bruders erzählen. So erwähnt die Schwester<br />
Pascals kaum mit einem Worte das moralisch und geschichtlich vernichtende Buch gegen die<br />
Jesuiten, die "Lettres écrites à un provincial". Der erste dieser Briefe (1656) war bestellte<br />
Jesuiten 103<br />
keit des Ordens, das hing schon wieder mit der geistigen Aufklärung zusammen,<br />
weil die Lehre der Physiokraten doch in ganz Europa mit der<br />
antichristlichen Propaganda verbunden war. Und schließlich hätte man<br />
blind sein müssen, um nicht zu sehen, daß die Enzyklopädisten das Feuer<br />
schürten, als sie vernahmen, es bereite sich ein Schlag gegen die Jesuiten<br />
in den Kabinetten vor. Nur lagen die Dinge nicht so einfach, wie katholische<br />
und antikatholische Bücher es darstellen. Als der Orden aufgehoben wurde,<br />
gewährte ihm just Friedrich der Große eine Freistatt in Schlesien; und<br />
nach der Wiederbelebung des Ordens wollte just Kaiser Franz von Österreich<br />
nichts von den Jesuiten wissen. So unchristlich, so weltlich, so politisch war<br />
das Abendland geworden, daß die Stellungnahme zu dem Orden, der die<br />
Armee der katholischen Kirche darstellte, von religiösen Rücksichten fast<br />
unabhängig war; nur auf dem Papier, nur in den Parteischriften hin und<br />
wieder war noch von theologischen Gegensätzen die Rede, wie z. B. von<br />
dem berüchtigten Probabilismus der Jesuiten.<br />
Wie die Jesuiten von Anfang an ein Heer bildeten im Dienste des<br />
politischen Papsttums, keinen eigentlichen religiösen Orden, so war auch<br />
die ganze Bewegung, die zur Aufhebung der Jesuiten führte, nicht ein<br />
Arbeit, im Dienste der von den Jesuiten verfolgten Jansenisten von Port-Royal: eine für<br />
uns veraltete Untersuchung über die (der Streit hat noch lange nachgewirkt) quaestio facti<br />
und quaestio juris. In den folgenden Briefen aber holte Pascal zu den wuchtigsten Schlägen<br />
aus gegen den Probabilismus und gegen die Kasuistik der jesuitischen Weltmoral. In hinreißender<br />
Sprache wird die Religion Jesu Christi (und auch die des Augustinus) gegen die<br />
herrschende christliche Religion verteidigt. Das Buch hatte einen ungeheueren Erfolg und<br />
wurde, nachdem auch eine lateinische Übersetzung die Wirkung über ganz Europa verbreitet<br />
hatte, (1660) vom Henker verbrannt.<br />
Wir dürfen bei Pascal an Kierkegaard denken, der ja auch mit seinem „Entweder —<br />
Oder" das Urchristentum zu retten vermeinte und zum radikalen Abfall führte. Dieser Zug<br />
einer Kritik aller Theologie (nach der Kritik der jesuitischen Theologen) ist um so überraschender<br />
und aufwühlender in den "Pensées", als dieses Werk nur Bruchstücke enthält, die Pascal in<br />
den Jahren der Krankheit für eine Apologie des Christentums niedergeschrieben hatte. An<br />
dieser Stelle, wo ich den Denker als einen Gegner der Jesuiten betrachte, ziemt es sich nicht<br />
recht, nur nebenbei der hohen "Pensées" zu gedenken. Ich wage aber die Versicherung,<br />
daß Pascal auch hier er selber blieb und zu Unrecht für die katholische Orthodoxie in Anspruch<br />
genommen wird. Über die Natur des Menschen denkt er so skeptisch, so zynisch meinetwegen,<br />
wie vor ihm und neben ihm nur Hobbes, Montaigne und La Rochefoucauld; man kann die<br />
Verachtung des Menschen nicht weiter treiben. Ein Skeptiker ist Pascal auch der Vernunft<br />
gegenüber; ein wahrer Philosoph sei, wer sich über die Philosophie lustig macht. Nun wird<br />
behauptet, Pascal habe die Menschen durch den Zweifel hindurch zum Glauben führen<br />
wollen. Das ist einfach nicht wahr; der Glaube kann ja — so lehrt er — weder durch Überlieferung<br />
noch durch Nachdenken sicher gestellt werden, nicht einmal durch die Sehnsucht des<br />
unvernünftigen Herzens. Der Glaube an Gott ist für den Mathematiker Pascal nicht mehr<br />
und nicht weniger als eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie der Gegenstand einer Wette.<br />
Offenbar ist Pascal selbst geneigt, an das Dasein Gottes zu glauben und darüber eine Wette<br />
einzugehen. Der Sinn ist etwa: ,,Der Teufel soll mich holen, wenn es keinen Gott gibt";<br />
mir scheint das nicht ganz die Sprache eines gläubigen Christen zu sein.