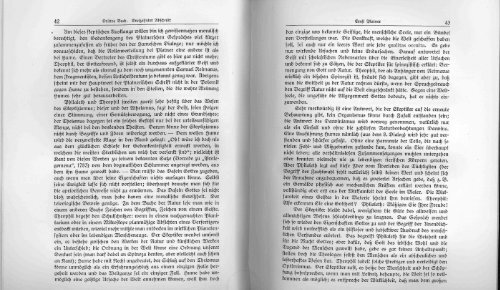Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
42 Drittes Buch. Dreizehnter Abschnitt<br />
Um dieses skeptischen Ausklangs willen bin ich gewissermaßen moralisch<br />
berechtigt, den Gedankengang des Platnerschen Gespräches viel kürzer<br />
zusammenzufassen als früher den der Humeschen Dialoge; nur möchte ich<br />
vorausschicken, daß die Rollenverteilung bei Platner eine andere ist als<br />
bei Hume. Einen Vertreter des Christentums gibt es hier gar nicht mehr;<br />
Theophil, der Gottesfreund, ist selbst ein durchaus aufgeklärter Deist und<br />
bekennt sich mehr als einmal zu dem noch ungenannten Samuel Reimarus,<br />
dem Fragmentisten, dessen Antichristentum ja bekannt genug war. Übrigens<br />
scheint mir der Hauptwert der Platnerschen Schrift nicht in der Polemik<br />
gegen Hume zu bestehen, sondern in den Stellen, die die wahre Meinung<br />
Humes sehr gut herausarbeiten.<br />
Philaleth und Theophil streiten zuerst sehr heftig über das Wesen<br />
des Skeptizismus; dieser und der Atheismus, sagt der Deist, seien Folgen<br />
einer Stimmung, einer Gemütsbewegung, und nicht eines Grundsatzes;<br />
der Theismus dagegen sei ein solches Gefühl nur bei der urteilsunfähigen<br />
Menge, nicht bei den denkenden Theisten. Darum könne der Skeptizismus<br />
nicht durch Begriffe und Ideen widerlegt werden. — Dem weisen Hume<br />
wird die verzweifelte Klage in den Mund gelegt: "Oh! wäre ich doch nie<br />
aus dem glücklichen Schlafe der Gedankenlosigkeit erweckt worden, in<br />
welchem die meisten Sterblichen um mich her versenkt sind"; vielleicht ist<br />
Kant von diesen Worten zu seinem bekannten Satze (Vorrede zu "Prolegomena",<br />
1783) von dem dogmatischen Schlummer angeregt worden, aus<br />
dem ihn Hume geweckt habe. — Man müsse das Dasein Gottes zugeben,<br />
auch wenn man über seine Eigenschaften nichts aussagen könne. Selbst<br />
seine Ewigkeit lasse sich nicht vorstellen; überhaupt brauche man sich für<br />
die apriorischen Beweise nicht zu erwärmen. Das Dasein Gottes sei nicht<br />
bloß wahrscheinlich, man habe davon eine moralische Gewißheit. Der<br />
teleologische Beweis genüge. In dem Buche der Natur lese man wie in<br />
einem anderen Buche Zeichen von Begriffen, Zeichen von einem Geiste.<br />
Theophil begeht den Schulschnitzer: wenn in einem nachgemachten Planitarium<br />
oder in einem Mikroskope planmäßige Absichten eines Verfertigers<br />
entdeckt würden, wieviel mehr müßte man entdecken im wirklichen Planetensystem<br />
oder im lebendigen Menschenauge. Der Skeptiker wendet umsonst<br />
ein, es bestehe zwischen den Werken der Natur und künstlichen Werken<br />
ein Unterschied; die Ordnung in der Welt könne eine Ordnung unserer<br />
Denkart sein (man darf dabei an Spinoza denken, aber vielleicht auch schon<br />
an Kant); Hume habe mit Recht angedeutet, der Schluß auf den Theismus<br />
könne unmöglich als ein Erfahrungsschluß aus einem einzigen Falle hergeholt<br />
werden und das Weltganze sei ein einziger Fall. Hume habe unmöglich<br />
eine geistige Ursache der Welt annehmen können, weil ihm doch<br />
Ernst Platner 43<br />
das einzige uns bekannte Geistige, die menschliche Seele, nur ein Bündel<br />
von Vorstellungen war. Die Denkkraft, welche die Welt geschaffen haben<br />
soll, sei auch nur ein leeres Wort wie jede qualitas occulta. Es gebe<br />
nur wirkende Ursachen und keine Endursachen. Darauf antwortet der<br />
Deist mit scholastischen Redensarten über die Einerleiheit aller Ursachen<br />
und bekennt sich zu Sätzen, die der Skeptiker für spinozistisch erklärt: Vermengung<br />
von Gott und Natur. Theophil, der als Anhänger von Reimarus<br />
wirklich ein bißchen Spinozist ist, sträubt sich dagegen, gibt aber zu, daß<br />
man die Gottheit zu der Natur rechnen dürfte, wenn der Sprachgebrauch<br />
den Begriff Natur nicht auf die Welt eingeschränkt hätte. Gegen eine Weltseele,<br />
die ungefähr die Allgegenwart Gottes bedeute, hat er nichts einzuwenden.<br />
Sehr merkwürdig ist eine Antwort, die der Skeptiker auf die erneute<br />
Behauptung gibt, kein Organismus könne durch Zufall entstanden sein;<br />
die Antwort des Darwinismus wird vorweg genommen, natürlich nur<br />
als ein Einfall und ohne die zahllosen Naturbeobachtungen Darwins.<br />
Eine Ausführung Humes nämlich (aus dem 8. Dialog) wird sehr gut verstanden<br />
und schärfer gefaßt. Ohne eine Harmonie der Teile, die nach so<br />
vielen Fehl- und Mißgeburten zustande kam, konnte ein Tier überhaupt<br />
nicht leben; alle verhältnislosen Zusammensetzungen mußten untergehen<br />
oder konnten vielmehr nie zu lebendigen tierischen Körpern geraten.<br />
Aber Philaleth legt auf diese Idee vom Überleben des Tüchtigsten (der<br />
Begriff der Zuchtwahl fehlt natürlich) selbst keinen Wert und scheint sich<br />
der Annahme anzubequemen, daß es zweierlei Ursachen gebe, daß z.B.<br />
ein Gemälde physisch aus mechanischen Kräften erklärt werden könne,<br />
vollständig aber erst aus der Wirksamkeit der Seele im Maler. Die Wirksamkeit<br />
eines Geistes in der Materie scheint ihm bewiesen. Theophil:<br />
Also erkennen Sie eine Gottheit ? Philaleth: Mäßigen Sie Ihre Freude!<br />
Der Skeptiker bleibt dabei, wenigstens die Güte des allweisen und<br />
allmächtigen Wesens schlechterdings zu leugnen. Das Gespräch wendet<br />
sich so wieder den Eigenschaften Gottes zu und der Begriff der Unendlichkeit<br />
wird vortrefflich als ein hilfloser und subjektiver Ausdruck des menschlichen<br />
Verstandes erörtert. Das begreift Philaleth für die Weisheit und<br />
für die Macht Gottes; aber dafür, daß Gott das irdische Wohl und die<br />
Tugend der Menschen gewollt habe, gebe es gar keinen Anhaltspunkt;<br />
stellen doch die Theologen selbst den Menschen als ein abscheuliches und<br />
lasterhaftes Wesen dar. Theophil tadelt solche Prediger und verteidigt den<br />
Optimismus. Der Skeptiker ruft, es heiße der Menschheit und der Schöpfung<br />
hohnsprechen, wenn man mit Leibniz behaupte, die Welt sei so vollkommen<br />
als möglich; es entspreche der Wirklichkeit, daß man dem großen