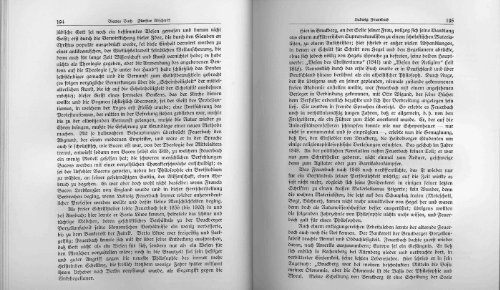Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
194 Viertes Buch. Fünfter Abschnitt<br />
jüdische Gott sei noch ein bestimmtes Wesen gewesen und darum nicht<br />
Geist; erst durch die Verwirklichung dieser Idee, die durch den Glauben an<br />
Christus populär ausgedrückt werde, sei diese Einheit verwirrt worden zu<br />
einer antikosmischen, der Wirklichkeitswelt feindlichen Weltanschauung, die<br />
denn auch für lange Zeit Wissenschaft und Kunst vernichtet habe; es habe<br />
nichts als Theologie gegeben, aber die Anwendung des angeborenen Denkens<br />
auf die Theologie („so unter der Hand") habe schließlich das Denken<br />
selbständiger gemacht und die Vernunft zum Selbstbewußtsein gebracht<br />
(es folgen vorzügliche Bemerkungen über die "Scheinheiligkeit" der mittelalterlichen<br />
Kunst, die ich auf die Scheinheiligkeit der Scholastik ausdehnen<br />
möchte) ; dieser Geist eines formalen Denkens, das der Kirche dienen<br />
wollte und die Dogmen schließlich überwand, sei der Geist des Protestantismus,<br />
in welchem der Logos erst Fleisch wurde; eine Fortführung des<br />
Protestantismus, der mitten in der Befreiung stehen geblieben war, mußte<br />
bis zu der allwissenden Vernunft gelangen, mußte die Natur wieder zu<br />
Ehren bringen, mußte die Erfahrung zur Grundlage einer neuen Methode<br />
machen. Mit so halbwahren Behauptungen überbrückt Feuerbach den<br />
Abgrund, der einen modernen Empiriker, und wäre er in der Sprache<br />
auch so scholastisch, wie Bacon oft war, von der Theologie des Mittelalters<br />
trennt, entwirft sodann von Bacon selbst ein Bild, zu welchem Feuerbach<br />
ein wenig Modell gesessen hat; die schweren menschlichen Verfehlungen<br />
Bacons werden mit einer verzeihlichen Charakterschwäche entschuldigt; es<br />
sei der Urfehler Bacons gewesen, neben der Philosophie ein Brotstudium<br />
zu wählen, an seiner gesetzmäßigen Gattin, der Wissenschaft, einen Ehebruch<br />
zu begehen. Es war aber doch wohl nicht dasselbe: wenn Francis<br />
Bacon Lordkanzler von England wurde und in dieser Herrscherstellung<br />
Verbrechen beging, wenn Ludwig Feuerbach immer wieder außerordentlicher<br />
Professor werden wollte und dafür kleine Menschlichkeiten beging.<br />
Als freier Schriftsteller lebte Feuerbach seit 1836 (bis 1860) in und<br />
bei Ansbach; hier lernte er Berta Löwe kennen, heiratete das schöne und<br />
tüchtige Mädchen, deren geschäftliches Verhältnis zu der Bruckberger<br />
Porzellanfabrik seine ökonomischen Verhältnisse ein wenig verbesserte,<br />
bis zu dem Bankerott der Fabrik. Berta Löwe war freigeistig und starkgeistig;<br />
Feuerbach konnte sich mit ihr über seine Entdeckung aussprechen,<br />
daß Gott nicht als ein Wesen für sich, sondern nur als ein Wesen für<br />
den Menschen vorzustellen wäre; noch in die Brautzeit fiel sein heftiger<br />
und guter Angriff gegen die neueste Philosophie des immer mehr<br />
christelnden Schelling, die freilich trotzdem wenige Jahre später mitsamt<br />
ihrem Urheber nach Berlin verpflanzt wurde, als Gegengift gegen die<br />
Linkshegelianer.<br />
Ludwig Feuerbach 195<br />
Hier in Bruckberg, an der Seite seiner Frau, vollzog sich seine Wandlung<br />
aus einem aufklärerischen Supranaturalisten zu einem scholastischen Materialisten,<br />
zu einem Antichristen; hier schrieb er außer vielen Abhandlungen,<br />
in denen er Schritt für Schritt von Hegel und den Hegelianern abrückte,<br />
ohne sich jedoch völlig von Hegels Sprache zu befreien, seine beiden Hauptwerke:<br />
„Wesen des Christentums" (1841) und „Wesen der Religion" (seit<br />
1845). Namentlich durch das erste Buch wurde er in Deutschland und über<br />
Deutschland hinaus berühmt als ein atheistischer Philosoph. Durch Ruge,<br />
der ihn übrigens auch an seiner geplanten, niemals zustande gekommenen<br />
freien Akademie anstellen wollte, war Feuerbach mit einem angesehenen<br />
Verleger in Verbindung gekommen, mit Otto Wigand, der seine Bücher<br />
dem Verfasser ordentlich bezahlte und sich ihre Verbreitung angelegen sein<br />
ließ. Sie wurden in fremde Sprachen übersetzt. So erlebte es Feuerbach<br />
noch in verhältnismäßig jungen Jahren, daß er allgemein, d. h. von den<br />
Freigeistern, als ein Führer zum Licht anerkannt wurde. Er, der auf die<br />
Universitätsprofessoren schimpfen konnte wie nur Schopenhauer — nur<br />
nicht so monumental und so einprägsam —, erlebte nun die Genugtuung,<br />
daß ihn, den Einsiedler von Bruckberg, die Heidelberger Studenten um<br />
einige religionsphilosophische Vorlesungen ersuchten. Das geschah im Jahre<br />
1848. An der politischen Revolution nahm Feuerbach keinen Teil; er war<br />
nur zum Schriftsteller geboren, nicht einmal zum Redner, geschweige<br />
denn zum Agitator oder zum Barrikadenkämpfer.<br />
Was Feuerbach nach 1848 noch veröffentlichte, das ist wieder nur<br />
für ein Verständnis seiner Persönlichkeit wichtig; auf die Zeit wirkte es<br />
fast nicht mehr, obgleich sich seine Freidenkerei in einigen seiner letzten<br />
Schriften zu einem krassen Materialismus steigerte; kein Wunder, denn<br />
die wahren Materialisten, die jetzt auf den Schauplatz traten (Moleschott,<br />
Vogt, Büchner), kamen nicht mehr unmittelbar von Hegel her und waren<br />
denn doch als Naturwissenschaftler besser ausgerüstet; übrigens wollten<br />
die folgenden Jahrzehnte von Philosophie nichts mehr wissen, und Feuerbach<br />
galt für einen Philosophen.<br />
Nach einem entsagungsreichen Arbeitsleben lernte der alternde Feuerbach<br />
auch noch die Not kennen. Der Bankerott der Bruckberger Porzellanfabrik<br />
brachte Armut und Obdachlosigkeit. Feuerbach dachte zuerst wieder<br />
daran, nach Amerika auszuwandern; Europa sei ein Gefängnis. Er ließ<br />
sich endlich in Rechenberg bei Nürnberg nieder und verbrachte dort, in<br />
verbitterter Einsamkeit, seine letzten Lebensjahre. Hier schrieb er in sein<br />
Tagebuch: "Bruckberg war bei meinen beschränkten Mitteln die Basis<br />
meiner Ökonomie, aber die Ökonomie ist die Basis der Philosophie und<br />
Moral. Meine Scheidung von Bruckberg ist eine Scheidung der Seele