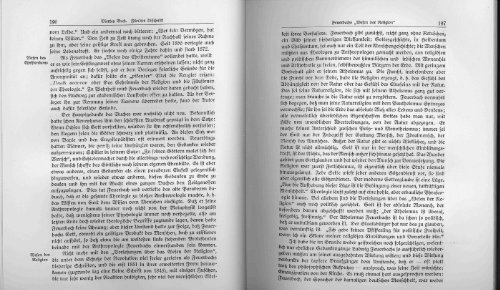Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
196 Viertes Buch. Fünfter Abschnitt<br />
vom Leibe." Und ein andermal noch bitterer: "Wer kein Vermögen, hat<br />
keinen Willen." Von Zeit zu Zeit drang noch der Nachhall seines Ruhms<br />
zu ihm, aber seine geistige Kraft war gebrochen. Seit 1866 versagte auch<br />
seine Lebenskraft. Er siechte noch einige Jahre dahin und starb 1872.<br />
Wesen des Als Feuerbach das "Wesen des Christentums" vollendet hatte, wollt<br />
er es wie sein Erstlingswerk ohne seinen Namen erscheinen lassen; nicht ganz<br />
aufrichtig gegen sich selbst, gab er dem Verleger feierliche Gründe für die<br />
Anonymität an; dafür sollte ein "pikanter" Titel die Neugier reizen:<br />
"\greek{,..7^.....: a^.^c^} oder Das Geheimnis der Religion und die Illusionen<br />
der Theologie." In Wahrheit wird Feuerbach wieder daran gedacht haben,<br />
sich den Rückweg zur akademischen Laufbahn offen zu halten. Als der Verleger<br />
ihn zur Nennung seines Namens überredet hatte, fand der Autor<br />
auch dafür feierliche Gründe.<br />
Der Hauptgedanke des Buches war wahrlich nicht neu. Bekanntlich<br />
hatte schon Xenophanes ihm den schärfsten Ausdruck geprägt in dem Satze:<br />
Wenn Ochsen sich Gott vorstellten, würden sie ihn ochsenähnlich vorstellen;<br />
den Negern seien die Götter schwarz und plattnäsig. An diesen Satz war<br />
von Bayle und den Enzyklopädisten oft erinnert worden. Neuerdings<br />
hatten Männer, die gewiß keine Umstürzler waren, den Gedanken wieder<br />
aufgenommen; Schiller in seinem Satze: „In seinen Göttern malet sich der<br />
Mensch", und Schieiermacher durch die allerdings noch vorsichtige Wendung,<br />
der Mensch schaffe das Göttliche nach seinem eigenen Ebenbilde. Es ist aber<br />
etwas anderes, einen Gedanken als einen paradoxen Einfall gelegentlich<br />
hinzuwerfen, und wieder etwas anderes, diesen Gedanken zu Ende zu<br />
denken und ihn mit der Wucht eines ganzen Buches den Zeitgenossen<br />
aufzuzwingen. Dies tat Feuerbach und vertiefte das alte Paradoxon dadurch,<br />
daß er die gesamte Theologie zu bloßer Anthropologie machte, d.h.<br />
das Wissen von Gott dem Wissen vom Menschen einfügte. Daß er seine<br />
Anthropologie damals immer noch nicht von der Metaphysik losgelöst<br />
hatte, daß wenigstens seiner Psychologie immer noch verhegelte, also am<br />
letzten Ende doch wieder theologische Begriffe zugrunde lagen, davon hatte<br />
Feuerbach keine Ahnung; aber dieser Umstand hatte zur Folge, daß Feuerbachs<br />
Gott, obwohl ein geistiges Produkt des Menschen, doch zu existieren<br />
nicht aufhört, so daß etwa die am weitesten links stehenden Protestanten<br />
beinahe mit der Anthropologie Feuerbachs einverstanden sein könnten.<br />
Wesen der Nicht mehr mit den "Vorlesungen über das Wesen der Religion",<br />
Religion die unter dem Schutze der Revolution viel freier gerieten als Feuerbachs<br />
bisherige Schriften, und die erst 1851 in ihrer erweiterten Form herauskamen<br />
(zugrunde lag eine kleine Schrift von 1845), mit einigen Zusätzen,<br />
die nur sehr wenig der Reaktion huldigten, sehr viel der menschlichen Eitel<br />
Feuerbachs "Wesen der Religion" 197<br />
keit ihres Verfassers. Feuerbach gibt zunächst, nicht ganz ohne Retuschen,<br />
ein Bild seiner bisherigen Wirksamkeit; Gottesgeschichte, in Heidentum<br />
und Christentum, sei auch nur ein Teil der Menschengeschichte; die Menschen<br />
müßten aus Theologen zu Anthropologen gemacht werden, aus religiösen<br />
und politischen Kammerdienern der himmlischen und irdischen Monarchie<br />
und Aristokratie zu freien, selbstbewußten Bürgern der Erde. Mit geringem<br />
Vorbehalt gibt er seinen Atheismus zu. Die Furcht, insbesondere aber<br />
die Furcht vor dem Tode, habe die Religion erzeugt, d. h. das Gefühl der<br />
Abhängigkeit von der Natur oder das Gefühl des Einsseins mit der Natur.<br />
Das sei seine Naturreligion, die sich mit seinem Atheismus ganz gut vertrage;<br />
man brauche ja die Natur nicht zu vergöttern. Feuerbach verwahrt<br />
sich dagegen, daß man seine Naturreligion mit dem Pantheismus Spinozas<br />
verwechsle; für ihn sei die Erde das absolute Maß alles Lebens und Denkens;<br />
alle vermeintlich überirdischen Eigenschaften Gottes habe man nur, mit<br />
Hilfe von unendlichen Übertreibungen, von der Natur abgezogen. Er<br />
mache keinen Unterschied zwischen Poly- und Monotheismus; immer sei<br />
der Gott nur der Inbegriff der Gattung Mensch, der Idealmensch, der<br />
Mensch des Wunsches. Außer der Natur gibt es nichts Wirkliches, und die<br />
Natur ist nicht allmächtig. Gott ist nur in der menschlichen Einbildungskraft,<br />
ist das Nichts, das der Mensch außer sich hinaus gesetzt hat. Das Wunder<br />
gehört zum Gottglauben und hat wieder den Wunsch zur Voraussetzung. Die<br />
Religion war zuerst Fetischismus, ist eigentlich über diese Stufe niemals<br />
hinausgelangt. Jede Sekte wirft jeder anderen Götzendienst vor, sie sind<br />
aber eigentlich alle Götzendiener. Der moderne Gottesglaube ist eine Lüge.<br />
"Nur die Aufhebung dieser Lüge ist die Bedingung einer neuen, tatkräftigen<br />
Menschheit." Theologie läuft zuletzt auf eine hohle, aber erbauliche Phraseologie<br />
hinaus. Bei alledem sind die Vorlesungen über das "Wesen der Religion"<br />
auch noch politisch gerichtet. Gott ist der absolute Monarch, der<br />
besonders darum abgeschafft werden muß; "der Atheismus ist liberal,<br />
freigebig, freisinnig." Der Atheismus Feuerbachs ist da schon so politisch,<br />
daß er unduldsam geworden ist. Der Staatsbürger hat nur das zu glauben,<br />
was vernünftig ist. "Ich gebe keinen Pfifferling für politische Freiheit,<br />
wenn ich ein Sklave meiner religiösen Einbildungen und Vorurteile bin."<br />
Ich habe die im Grunde weder geistreichen noch folgerichtigen, wesentlich<br />
nur ehrlichen Gedankengänge Ludwig Feuerbachs so ausführlich wiedergeben<br />
müssen um seiner ausgedehnten Wirkung willen; und diese Wirkung<br />
verdankte der tapfere Draufgänger dem Umstande, daß er — oft platt<br />
trotz des philosophischen Aufputzes — aussprach, was seine Zeit wünschte:<br />
Emanzipation von der Kirche. Es muß einmal hart ausgesprochen werden:<br />
Feuerbach, der Sprecher der damaligen deutschen Menschheit, war weder