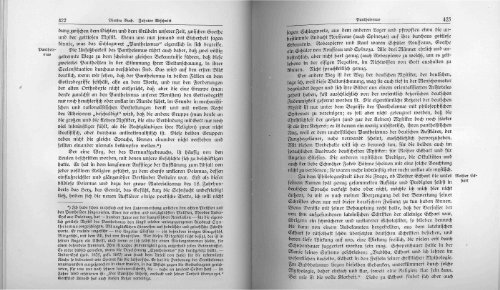Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
422 Viertes Buch. Zehnter Abschnitt<br />
dung zwischen dem Dichten und dem Grübeln unserer Zeit, zwischen Goethe<br />
und der gottlosen Mystik. Wenn uns nur jemand mit Sicherheit sagen<br />
könnte, was das Schlagwort "Pantheismus" eigentlich in sich begreife.<br />
Die Unfaßbarkeit des Pantheismus rührt auch daher, daß zwei völlig<br />
getrennte Wege zu dem scheinbar gleichen Bekenntnisse führen, daß diese<br />
zweierlei Pantheisten in der Stimmung ihrer Weltanschauung, in ihrer<br />
Seelensituation durchaus verschieden sind. Das wird auf den ersten Blick<br />
deutlich, wenn wir sehen, daß der Pantheismus in beiden Fällen an dem<br />
Gottesbegriffe festhält, also an dem Worte, und nur den Forderungen<br />
der alten Orthodoxie nicht entspricht, daß aber die eine Gruppe (man<br />
denke zunächst an den Pantheismus unserer Monisten) den Gottesbegriff<br />
nur noch heuchlerisch oder unklar im Munde führt, im Grunde in mechanistischen<br />
und rationalistischen Vorstellungen denkt und mit vollem Recht<br />
des Atheismus „beschuldigt" wird, daß die andere Gruppe (man denke an<br />
die großen und die kleinen Mystiker, die eine Verbindung mit Gott nur noch<br />
viel inbrünstiger fühlt, als die Rechtgläubigen ihre Religion) zwar nicht<br />
idealistisch, aber durchaus antirationalistisch ist. Diese beiden Gruppen<br />
reden nicht die gleiche Sprache, können einander nicht verstehen und<br />
sollten einander niemals bekämpfen wollen.*)<br />
Der eine Weg, der des Vernunftgebrauchs, ist häufig von den<br />
Leuten beschritten worden, mit denen unsere Geschichte sich zu beschäftigen<br />
hatte. Er hat in dem langsamen Aufstiege der Aufklärung zum Abfall von<br />
jeder positiven Religion geführt, zu dem ebenso unklaren Deismus, dessen<br />
einflußreichster und glänzendster Verkünder Voltaire war. Erst als dieser<br />
bildlose Deismus und dazu der graue Materialismus des 18. Jahrhunderts<br />
das Herz, das Gemüt, das Gefühl, kurz die Sehnsucht unbefriedigt<br />
ließ, holten sich die neuen Aufklärer einige poetische Werte, ich will nicht<br />
*) Ich habe schon mehrfach auf den Zusammenhang zwischen den echten Pietisten und<br />
den Pantheisten hingewiesen. Einer der ersten und vorzüglichsten Pietisten, Theodor Under-<br />
Eyck aus Duisburg, hat — hundert Jahre vor der französischen Revolution — für die eigentlich<br />
gottlose Mystik des Pantheismus den längst wieder untergegangenen Ausdruck Syntheismus<br />
vorgeschlagen. Mit unglücklichen Hinweisen auf hebräische und griechische Schriftworte.<br />
Er meinte ungefähr — wie Angelus Silesius — ein besonders inniges Einsgefühl,<br />
Mitgefühl, mit dem All, frei von Konfession. Wer dieses Mitgefühl nicht besitzt, der ist in<br />
seinen Augen ein Atheist, auch wenn er sich selbst für einen Wiedergeborenen hielte, für<br />
einen besonders frommen. Ihm ist wahre Frömmigkeit ganz außerhalb jedes Bekenntnisses.<br />
Es wäre hübsch gewesen, wenn die Bezeichnung "Syntheismus" sich durchgesetzt hätte. —<br />
Under-Eyck (geb. 1635, gest. 1693) war (nach dem Urteil von Hase) für die reformierte<br />
Kirche so bedeutend wie Spener für die lutherische. Er hat die Forderung des Syntheismus<br />
unumwunden ausgesprochen in einer krausen, in der Absicht gegen die Gottesleugner gerichteten,<br />
für uns nur noch schwer lesbaren Schrift, die — nahe an tausend Seiten stark — im<br />
Jahre 1689 erschienen ist: "Der Närrische Atheist, entdeckt und seiner Torheit überzeuget."<br />
Gottfried Arnold hat auch diesen Ketzer verteidigt.<br />
Pantheismus 423<br />
sagen Schlagworte, aus dem anderen Lager und pfropften etwa die unbestimmte<br />
Andacht Rousseaus (auch Spinozas) auf ihre durchaus gottlose<br />
Erkenntnis. Robespierre und Kant waren Schüler Rousseaus, Goethe<br />
ein Schüler von Rousseau und Spinoza. Alle drei Männer ehrlich und unbestechlich,<br />
aber nicht hart genug (auch Robespierre zu weich), um es zeitlebens<br />
in der eisigen Negation, im Nichtwissen von Gott aushalten zu<br />
können. Nicht sprachkritisch genug.<br />
Der andere Weg ist der Weg der deutschen Mystiker, der deutschen,<br />
sage ich, weil diese Weltanschauung, mag sie auch tief in der Menschennatur<br />
begründet liegen und sich ihre Bilder aus einem orientalisierten Aristoteles<br />
geholt haben, fast ausschließlich von der wesentlich ketzerischen deutschen<br />
Frömmigkeit geformt worden ist. Die eigentümliche Ketzerei der deutschen<br />
Mystik ist nur unter dem Begriffe des Pantheismus mit philosophischen<br />
Systemen zu vereinigen; es soll aber nicht geleugnet werden, daß die<br />
Christlichkeit der großen (und gar der kleinen) Mystiker doch noch stärker<br />
ist als ihre Ketzerei; es ist darum ein wenig unhistorisch, ihren pantheistischen<br />
Zug, weil er dem unchristlichen Pantheismus der deutschen Aufklärer, der<br />
Junghegelianer, nahe verwandt scheint, ausschließlich hervorzuheben.<br />
Mit diesem Vorbehalte will ich es dennoch tun, für die beiden auch im<br />
sprachlichen Ausdrucke deutschesten Mystiker: für Meister Eckhart und für<br />
Angelus Silesius. Die anderen mystischen Prediger, die Okkultisten und<br />
auch der liebe Schwätzer Jakob Böhme scheinen mir eine solche Beachtung<br />
nicht zu verdienen; sie waren mehr inbrünstig oder mehr unklar als mystisch.<br />
Zu dem Philologenstreit über die Frage, ob Meister Eckhart die unter<br />
seinem Namen spät genug gesammelten Aufsätze und Predigten selbst in<br />
deutscher Sprache verfaßt habe oder nicht, möchte ich mich hier nicht<br />
äußern, da wir es nach meiner Überzeugung bei der Bewertung seiner<br />
Schriften eben nur mit dieser deutschen Fassung zu tun haben können.<br />
Wenn Denifle mit seiner Behauptung recht hatte, daß der Verfasser der<br />
von ihm aufgefundenen lateinischen Schriften der alleinige Eckhart war,<br />
übrigens ein schwächerer und unklarerer Scholastiker, so blieben dennoch<br />
die dann von einem Unbekannten hergestellten, aus dem lateinischen<br />
Eckhart so rätselhaft schön übersetzten deutschen Schriften bestehen, und<br />
deren tiefe Wirkung auf uns, eine Wirkung freilich, die vielen erst durch<br />
Schopenhauer suggeriert worden sein mag. Schopenhauer hatte in der<br />
Manie seines Systems geschrieben: „Buddha, Eckhart und ich lehren im<br />
wesentlichen dasselbe, Eckhart in den Fesseln seiner christlichen Mythologie.<br />
Im Buddhaismus liegen dieselben Gedanken, unverkümmert durch solche<br />
Mythologie, daher einfach und klar, soweit eine Religion klar sein kann.<br />
Bei mir ist die volle Klarheit." Liebe zu Eckhart findet sich aber auch