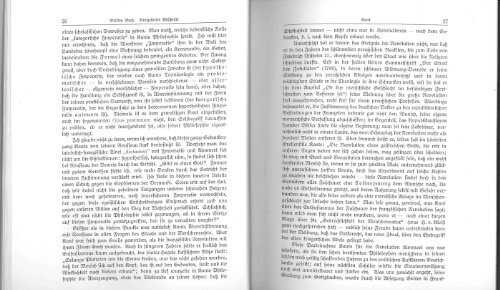Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
26 Drittes Buch. Dreizehnter Abschnitt<br />
eines scholastischen Beweises zu geben. Man weiß, welche bedenkliche Rolle<br />
der "kategorische Imperativ" in Kants Philosophie spielt. Ich will hier<br />
nur erwähnen, daß die Wortform "Imperativ" ihm in der Welt des<br />
Handelns überhaupt eine Mahnung bedeutet, ein Kommando, ein Gebot,<br />
insbesondere die Formel eines solchen zwingenden Gebotes. Der Zwang<br />
kann daher kommen, daß die vorzunehmende Handlung zwar nicht Selbstzweck,<br />
aber doch Vorbedingung eines gewollten Zweckes ist (der hypothetische<br />
Imperativ, der wieder nach Kants Terminologie ein problematischer<br />
— in verschiedenen Berufen verschiedener — oder assertorischer<br />
— allgemein menschlicher — Imperativ sein kann), oder daher,<br />
daß die Handlung ein Selbstzweck ist, in Übereinstimmung mit der Form<br />
der reinen praktischen Vernunft, von ihr selbst bestimmt (der kategorische<br />
Imperativ, der im Gegensatze zu dem heteronomen hypothetischen Imperativ<br />
autonom ist). Niemals ist es dem gewaltigen Kant eingefallen,<br />
auch im sogenannten Opus postumum nicht, den Sollbegriff daraufhin<br />
zu prüfen, ob er nicht transzendent sei, also seiner Philosophie eigentlich<br />
untersagt.<br />
Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, daß dieser ganze Gedankengang<br />
Kants von seinem Rousseau stark beeinflußt ist. Übersetzt man das<br />
lateinisch-französische Wort "dictamen" mit Imperativ und kümmert sich<br />
nicht um die Distinktionen: hypothetisch, kategorisch usw., so findet sich schon<br />
bei Rousseau der Beweis durch das Gefühl. "Gibt es einen Gott? Immer<br />
mit gutem Gewissen fühle ich, wie mein Denken durch das Gewicht der<br />
inneren Zustimmung verstärkt wird. Ich finde in diesem inneren Urteile<br />
einen Schutz gegen die Sophismen der Vernunft. Seien wir auf der Hut,<br />
daß wir dabei nicht die geheimen Neigungen unseres schwachen Herzens<br />
mit dem noch geheimeren, noch innerlicheren Imperativ verwechseln,<br />
der gegen diese egoistischen Entscheidungen Einspruch erhebt und uns<br />
gegen unseren Willen auf den Weg der Wahrheit zurückführt. Schließlich,<br />
wie oft war nicht die Philosophie selbst gezwungen, all in ihrem Stolze<br />
auf diesen Imperativ zurückzugreifen, den sie zu verachten vorgibt?"<br />
Größer als in diesem Punkte war natürlich Kants Übereinstimmung<br />
mit Rousseau in allen Fragen des Staats und der Menschenrechte. Aber<br />
Kant war früh zum Greise geworden, als die französische Revolution mit<br />
ihren Ideen Ernst machte. Auch in jüngeren Jahren hätte er freilich den<br />
Enthusiasmus kaum aufgebracht, der hinter Hegels klassischem Witze steckt:<br />
"Solange Planeten um die Sonne kreisen, war das nicht gesehen worden,<br />
daß der Mensch sich auf den Kopf, das ist auf den Gedanken, stellt und die<br />
Wirklichkeit nach diesem erbaut"; denn zu tief wurzelte in Kants Philosophie<br />
die Überzeugung, eben das Bleibende an seiner Lehre: daß die<br />
Kant 27<br />
Wirklichkeit immer — nicht etwa nur in Revolutionen — nach dem Gedanken,<br />
d. i. nach dem Kopfe erbaut werde.<br />
Unterschätzt hat er darum das Ereignis der Revolution nicht, nur daß<br />
er in den Jahren der schlimmsten preußischen Reaktion, bis zum Tode von<br />
Friedrich Wilhelm II., ebensowenig über den Staat wie über die Religion<br />
schreiben durfte. Erst in der späten kleinen Sammelschrift "Der Streit<br />
der Fakultäten" (1798), in deren schlauen Widmung-Vorrede er seine<br />
Stellung zu den preußischen Königen auseinandersetzt und in deren<br />
wichtigstem Stücke er die Theologie in ihre Schranken weist, erst da hat er<br />
(in dem Kapitel "Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten<br />
zum Besseren sei") seine Meinung über die große Revolution<br />
frei ausgesprochen, recht frei für einen preußischen Professor. Allerdings<br />
behauptet er, die Zustimmung des deutschen Volkes zu den republikanischen<br />
Bestrebungen der Franzosen bedeute gar nicht den Wunsch, seine eigene<br />
monarchische Verfassung abzuschaffen; im Gegenteil, das Republikanisieren<br />
fremder Völker stärke die eigene Regierung; man sei kein Jakobiner, vornehmlich<br />
nicht in einem Lande, das vom Schauplatz der Revolution mehr als<br />
hundert Meilen entfernt ist. Aber dennoch heißt es, leider fast im härtesten<br />
Greisenstile Kants: „Die Revolution eines geistreichen Volks, die wir in<br />
unseren Tagen haben vor sich gehen sehen, mag gelingen oder scheitern;<br />
sie mag mit Elend und Greueltaten dermaßen angefüllt sein, daß ein wohl<br />
denkender Mensch sie, wenn er sie zum zweiten Male unternehmend glücklich<br />
auszuführen hoffen könnte, doch das Experiment auf solche Kosten<br />
zu machen nie beschließen würde — diese Revolution findet doch in den<br />
Gemütern aller Zuschauer eine Teilnehmung dem Wunsche nach, die<br />
nahe an Enthusiasmus grenzt, und deren Äußerung selbst mit Gefahr verbunden<br />
war, die also keine andere als eine moralische Anlage im Menschengeschlecht<br />
zur Ursache haben kann." Man lese genau, zweimal, was Kant<br />
über den Enthusiasmus der Zuschauer der französischen Revolution sagt;<br />
dann wird man sich nicht mehr wundern, wenn er — nach einer kurzen<br />
Klage über die "Gebrechlichkeit der Menschennatur" (was H. v. Kleist<br />
gern nachgesprochen hat) — endlich seine Freude kaum unterdrücken kann<br />
bei der Meldung, daß das Volksksrecht, das neue Ideal, über den Ehrbegriff<br />
des alten kriegerischen Adels gesiegt habe.<br />
Diese Parteinahme Kants für die Revolution kümmert uns nur<br />
insofern, als sie den schon berühmten Philosophen wenigstens in seinen<br />
letzten noch geistig schaffenden Jahren zu den politischen Aufklärern Deutschlands<br />
gesellt; auf seine nächsten Schüler wirkte die Staatsumwälzung<br />
noch viel unmittelbarer und stärker ein. Was uns zunächst angeht, seine<br />
Stellung zum Gottglauben, wurde durch die Absetzung Gottes in Frank