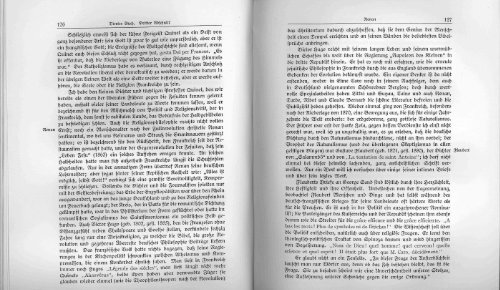Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
126 Viertes Buch. Dritter Abschnitt<br />
Schließlich erweist sich der kühne Freigeist Quinet als ein Deist von<br />
ganz besonderer Art: sein Gott ist zwar so gut wie unpersönlich, aber er ist<br />
ein französischer Gott; die Ereignisse der Weltgeschichte sind allesamt, wenn<br />
Quinet auch diesen Schluß nicht gezogen hat, gesta Dei per Francos. „Es<br />
ist offenbar, daß die Niederlage von Waterloo eine Fügung des Himmels<br />
war." Der Katholizismus habe es versäumt, durch rechtzeitigen Anschluß<br />
an die Revolution liberal oder demokratisch zu werden; er werde darum in<br />
der übrigen kleinen Welt als eine Sekte weiter bestehen, aber er werde aufhören,<br />
die Seele oder die Religion Frankreichs zu sein.<br />
Ich habe den kleinen Dichter und tüchtigen Professor Quinet, den wir<br />
bereits als einen der liberalen Führer gegen die Jesuiten kennen gelernt<br />
haben, anstatt vieler seiner Landsleute zu Worte kommen lassen, weil er<br />
bezeichnend ist für den Mischmasch von Politik und Religionskritik, der in<br />
Frankreich, dem sonst so radikalen Lande, das Bedürfnis der Halbgebildeten<br />
zu befriedigen schien. Auch die Religionsphilosophie machte nicht vollen<br />
Ernst; noch ein Menschenalter nach der Julirevolution christelte Renan<br />
sentimental, wo bei uns Reimarus und Strauß die Grundmauern gestürzt<br />
hatten; es ist bezeichnend für den Rückschritt, den Frankreich seit der Restauration<br />
gemacht hatte, unter der Gegenrevolution der Jesuiten, daß sein<br />
"Leben Jesu" (1863) ein solches Aufsehen erregen konnte. An solchen<br />
Halbheiten hatte man sich außerhalb Frankreichs längst die Schuhsohlen<br />
abgelaufen. Nur in der anmutigen Form übertraf Renan seine deutschen<br />
Lehrmeister; aber sogar hinter seiner skeptischen Keckheit wie: „Alles ist<br />
möglich, selbst Gott!" verbirgt sich eine gewisse Bereitwilligkeit, Kompromisse<br />
zu schließen. Vollends die Dichter und die Journalisten spielten nur<br />
mit der Geistesbefreiung; das Erbe der Enzyklopädisten war über den Rhein<br />
ausgewandert, war an das junge Deutschland und zu den Religionsfeinden<br />
um Feuerbach gelangt; der Kreis, der in Paris für die romantische Dichtung<br />
gekämpft hatte, war in das Philistertum der Form geflüchtet oder hatte im<br />
romantischen Sozialismus des Saintsimonismus ein politisches Feld gefunden.<br />
Auch Victor Hugo (geb. 1802, gest. 1885), den die Franzosen ohne<br />
Distanzgefühl neben Shakespeare und Goethe stellen, verkündete sechzig<br />
Jahre lang nur eine Mosaikreligion, zu welcher die Bibel, die große Revolution<br />
und gegohrene Überreste deutscher Philosophie Beiträge liefern<br />
mußten. Das französische Volk hatte nichts dagegen, daß seine Regierungen<br />
in der Kirchenpolitik schwankten zwischen Atheismus und Kompromissen,<br />
die einem Konkordat ähnlich sahen. Man liest in Frankreich<br />
immer noch Hugos "Légende des s i è c l e s " , man liest längst nicht mehr<br />
Quinets "Ahasvérus", beide Epen haben aber verwandte Züge: sie<br />
glauben wieder einmal (wie die Theophilanthropen nach der Revolution)<br />
Renan 127<br />
das Christentum dadurch abzuschaffen, daß sie dem Genius der Menschheit<br />
einen Tempel errichten und an seinen Wänden die beliebtesten Bibelsprüche<br />
anbringen.<br />
Victor Hugo reicht mit seinem langen Leben und seinem unermüdlichen<br />
Schaffen bis weit über die Regierung "Napoleon des Kleinen" in<br />
die dritte Republik hinein. Er hat es noch mit erfahren, wie die erneute<br />
jesuitische Philosophie in Frankreich durch die aus England übernommenen<br />
Gedanken der Evolution bekämpft wurde. Ein eigener Denker ist da nicht<br />
erstanden, weder in Elme Caro noch in seinem Nachfolger, dem auch<br />
in Deutschland vielgenannten Schönredner Bergson; doch durch wertvolle<br />
Spezialarbeiten haben Littré und Guyau, Taine und auch Renan,<br />
Tarde, Ribot und Claude Bernard die schöne Literatur befreien und die<br />
Publizistik heben geholfen. Wieder einmal ging von Frankreich, besonders<br />
nach der Niederlage von 1870, eine Bewegung aus, die sich für einige Jahrzehnte<br />
die Welt eroberte: der erdgeborene, ganz gottlose Naturalismus.<br />
Der Führer war erst der starke Zola, gegen dessen Verdienste ich einst nicht<br />
gerecht war, weil ich zu ungeduldig war, es zu erleben, daß die deutsche<br />
Dichtung durch den Naturalismus hindurchkäme, nicht an ihm vorbei; der<br />
Prophet des Naturalismus (und des überlegenen Skeptizismus in allen<br />
geistigen Dingen) war Gustave Flaubert (geb. 1821, gest. 1880), der Dichter Flaubert<br />
von „Salammbô" und von "La tentation de saint Antoine"; ich darf nicht<br />
einmal bei dieser heimlich lachenden, ganz antichristlichen Schrift verweilen.<br />
Nur ein Wort will ich versuchen über einige seiner intimen Briefe<br />
und über sein letztes Werk.<br />
Flauberts Briefe an George Sand sind köstlich durch ihre Herzlichkeit,<br />
ihre Heftigkeit und ihre Offenheit. Unbestochen von der Tagesmeinung,<br />
beobachtet Flaubert Menschen und Dinge und hat selbst während des<br />
deutsch-französischen Krieges für seine Landsleute oft härtere Worte als<br />
für die Preußen. Er ist auch in der Politik ein ausgesprochener Nominalist;<br />
die Parteigänger des Kaiserreichs und der Republik scheinen ihm ebenso<br />
dumm wie die Streiter für die grâce efficace und die grâce efficiente. "A<br />
bas les mots! Plus de symboles ni de fétiches! Die Wissenschaft soll über<br />
die Politik entscheiden, natürlich auch über religiöse Fragen. Er lernt den<br />
theologisch-politischen Traktat von Spinoza kennen und wird hingerissen<br />
von Begeisterung. "Nom de Dieu! quel homme! quel cerveau! quelle<br />
science et quel esprit! Il était plus fort que M. Caro, décidément."<br />
Er glaubt nicht an ein Jenseits. "In dieser Frage der Unsterblichkeit<br />
tauscht man nur Wörter aus, denn ob das Ich bestehen bleibt, das ist die<br />
Frage. Sie zu bejahen scheint mir eine Unverschämtheit unseres Stolzes,<br />
eine Auflehnung unserer Schwäche gegen die ewige Ordnung."