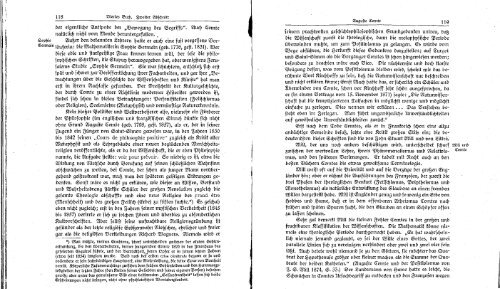Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
118 Viertes Buch. Zweiter Abschnitt<br />
der eigentliche Antipode der „Bewegung des Begriffs". Auch Comte<br />
natürlich nicht vom Monde heruntergefallen.<br />
Sophie Außer den bekannten Lehrern hatte er auch eine fast vergessene Vor-<br />
Germain läuferin: die Mathematikerin Sophie Germain (geb. 1776, gest. 1831). Wer<br />
diese edle und starkgeistige Frau kennen lernen will, der lese die philosophischen<br />
Schriften, die Stupuy herausgegeben hat, oder wenigstens Jerusalems<br />
Studie „Sophie Germain". Sie war schüchtern, entschloß sich erst<br />
spät und schwer zur Veröffentlichung ihrer Facharbeiten, und gar ihre „Betrachtungen<br />
über die Geschichte der Wissenschaften und Künste" hat man<br />
erst in ihrem Nachlasse gefunden. Der Dreischritt der Kulturgeschichte,<br />
der durch Comte zu einer Richtlinie moderner Historiker geworden ist,<br />
findet sich schon in diesen Betrachtungen: Personifikation (Fetischismus<br />
oder Religion), Seelenlehre (Metaphysik) und vernünftige Naturerkenntnis.<br />
Kein bloßer Politiker und Weltverbesserer also, vielmehr ein Förderer<br />
der Philosophie (im englischen und französischen Sinne) dünkte sich nicht<br />
ohne Grund Auguste Comte (geb. 1798, gest. 1857), als er, der in seiner<br />
Jugend ein Jünger von Saint-Simon gewesen war, in den Iahren 1830<br />
bis 1842 seinen „Cours de philosophie positive" zugleich als Kritik aller<br />
Metaphysik und als Lehrgebäude einer neuen beglückenden Menschheitsreligion<br />
veröffentlichte, als er da der Wissenschaft, die er eben Philosophie<br />
nannte, die Aufgabe stellte: voir pour prévoir. So niedrig es ist, etwa die<br />
Wirkung von Nietzsche durch Berufung auf seinen schließlichen Wahnsinn<br />
abschwächen zu wollen, bei Comte, der schon als junger Mann vorübergehend<br />
geisteskrank war, muß man der späteren geistigen Störungen gedenken.<br />
Sonst wäre es nicht zu erklären, wie dieser an Wissen, Verstand<br />
und Wahrheitsdrang stärkste Schüler der großen Revolution zugleich die<br />
gesamte Theologie abschaffte und eine neue Religion des grand être<br />
(Menschheit) und des großen Fetisch (Erde) zu stiften suchte.*) Es geschah<br />
eben nicht zugleich; erst in den Iahren seiner mystischen Verliebtheit (1845<br />
bis 1857) verirrte er sich zu solchen Ideen und überdies zu absonderlichen<br />
Kultvorschriften. Aber selbst seine unfruchtbare Religionsgründung ist<br />
gesünder als der letzte religiöse Größenwahn Nietzsches, ehrlicher und freier<br />
gar als die religiösen Verkleidungen Richard Wagners. Niemals wird er<br />
*) Man müßte, meines Erachtens, scharf unterscheiden zwischen der akuten Gehirnerkrankung,<br />
die den überarbeiteten, immer hungernden Comte 1826 in das Irrenhaus des<br />
gefeierten Esquirol führte, und der Verrücktheit, deren Opfer er in seinen letzten Jahren<br />
(etwa seit 1854) langsam wurde. Bald nach der ersten crise cérébrale begann er ja und<br />
vollendete er sein sechsbändiges Hauptwerk, eine Riesenleistung, die keine Spur von Narrheit<br />
verrät. Körperliche Zusammenhänge zwischen dem frühen Gehirnleiden und den Hemmungslosigkeiten<br />
der letzten Jahre (den Kulten seiner Geliebten und seiner eigenen Person) bestehen<br />
gewiß; aber unter das gemeinsame Bild einer bestimmten "Geisteskrankheit" lassen sich beide<br />
Erscheinungen nicht bringen, nicht ohne psychiatrischen Wortaberglauben.<br />
Auguste Comte 119<br />
seinem prachtvollen geschichtsphilosophischen Grundgedanken untreu, daß<br />
die Wissenschaft zuerst die theologische, dann die metaphysische Periode<br />
überwinden mußte, um zum Positivismus zu gelangen. Es würde vom<br />
Wege abführen, die Herkunft dieses Gedankens darzustellen; auf Turgot<br />
und Saint-Simon als die Vorgänger Comtes ist schon hingewiesen worden;<br />
besonders zu beachten wäre auch Vico. Die nüchternste und doch klarste<br />
Prägung dessen, was vom Positivismus bleiben wird, scheint mir das berühmte<br />
Wort Kirchhoffs zu sein, daß die Naturwissenschast nur beschreiben<br />
und nicht erklären könne; Ernst Mach hatte das, er sicherlich ein Schüler und<br />
Überwinder von Comte, schon vor Kirchhoff sehr schön ausgesprochen, da<br />
er (in einem Vortrage vom 15. November 1871) sagte: "Die Naturwissenschaft<br />
hat die komplizierteren Tatsachen in möglichst wenige und möglichst<br />
einfache zu zerlegen. Dies nennen wir erklären .. . Das Verstehen besteht<br />
eben im Zerlegen. Man führt ungewöhnliche unVerständlichkeiten<br />
auf gewöhnliche Unverständlichkeiten zurück."<br />
Erst nach dem Tode Comtes, als er in Frankreich schon eine allzu<br />
andächtige Gemeinde besaß, setzte eine Kritik großen Stils ein; die bedeutendsten<br />
dieser Schriften sind die von John Stuart Mill und von Littré.<br />
Mill, der uns noch anders beschäftigen wird, unterscheidet scharf Mill und<br />
zwischen der wertvollen Lehre, ihrem Phänomenalismus und Relativis- Comte<br />
mus, und den späteren Verirrungen. Er tadelt mit Recht auch an den<br />
besten Büchern Comtes die etwas gewaltsame Terminologie.<br />
Mill weist oft auf die Priorität und auf die Vorzüge der großen Engländer<br />
hin; aber er rühmt die Ausführungen des Franzosen, der zuerst die<br />
drei Phasen der theologischen Denkart (Fetischismus, Polytheismus und<br />
Monotheismus) als natürliche Entwicklung des Glaubens an einen fremden<br />
Willen dargestellt habe. Mill ist Engländer genug und so wenig ein Erbe von<br />
Hobbes und Hume, daß er in dem offenbaren Atheismus Comtes nach<br />
frühen und späten Spuren sucht, die den Glauben an einen Schöpfer offen<br />
zu lassen scheinen.<br />
Sehr gut bemerkt Mill die kleinen Fehler Comtes in der großen und<br />
fruchtbaren Klassifikation der Wissenschaften. Die Mathematik könne niemals<br />
eine theologische Periode durchgemacht haben. "Es hat wahrscheinlich<br />
niemals jemand geglaubt, es sei der Wille eines Gottes, der zwei<br />
parallele Linien sich zu vereinigen verhindert oder zwei und zwei vier sein<br />
läßt. Auch betete wohl niemand je zu den Göttern, sie möchten das Quadrat<br />
der Hypothenuse größer oder kleiner machen als die Summe der Quadrate<br />
der beiden Katheten." (Auguste Comte und der Positivismus von<br />
J. S. Mill 1874, S. 33.) Der Landsmann von Hume hatte es leicht, die<br />
Schwächen in Comtes Ursachbegriff zu entdecken und den Franzosen wegen