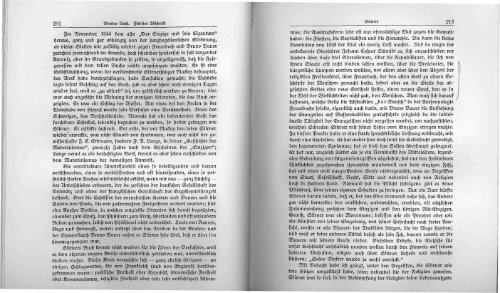Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
212 Viertes Buch. Fünfter Abschnitt<br />
Im November 1844 kam also „Der Einzige und sein Eigentum"<br />
heraus, ganz und gar abhängig von der junghegelianischen Strömung,<br />
an vielen Stellen wie zufällig wieder gegen Feuerbach und Bruno Bauer<br />
gerichtet (vernichtend im Grunde, doch scheinbar spielerisch in fast tanzender<br />
Anmut), aber im Grundgedanken so zeitlos, so unzeitgemäß, daß die Zeitgenossen<br />
mit dem tollen Buche nichts anzufangen wußten. Es ist eine<br />
Selbsttäuschung, wenn der verdienstvolle Stirnerjünger Mackay behauptet,<br />
das Werk habe durchgeschlagen, habe Sensation gemacht; die Behörde<br />
legte sofort Beschlag auf das Buch, gab es aber schon nach wenigen Tagen<br />
wieder frei, weil es "zu absurd" sei, um gefährlich werden zu können; dies<br />
war auch ungefähr die Meinung der wenigen Literaten, die das Buch anzeigten.<br />
Es war ein Schlag ins Wasser. Nur etwa bei den Freien in der<br />
Weinstube von Hippel wurde sein Verfasser eine Berühmtheit. Dann das<br />
Schweigen, das Verschollensein. Niemals hat ein bedeutender Geist das<br />
furchtbare Schicksal, lebendig begraben zu werden, so heiter getragen wie<br />
Stirner. Er erstickte lachend. Der erste, der vor Mackay den toten Stirner<br />
wieder erweckte, war nicht Eduard von Hartmann, war auch nicht der gewissenhafte<br />
J. E. Erdmann, sondern F. A. Lange, in seiner "Geschichte des<br />
Materialismus", zwanzig Jahre nach dem Erscheinen des "Einzigen";<br />
Lange nennt es ein berüchtigtes Werk, trennt es aber schon entschieden von<br />
dem Materialismus der damaligen Umwelt.<br />
Die unmittelbare Unwirksamkeit eines so beleidigenden und darum<br />
verführenden, eines so verblüffenden und oft hinreißenden, eines so persönlich<br />
starken Buches wird vielleicht erklärt, wenn wir uns — ganz flüchtig —<br />
des Unterschiedes erinnern, der da zwischen der deutschen Gesellschaft des<br />
Vormärz und etwa der französischen Gesellschaft der Enzyklopädistenzeit<br />
bestand. Dort die Schlösser der vornehmsten Herren und Damen und die<br />
Salons von Paris, die von zielbewußten Freigeistern erobert wurden; hier<br />
eine Kneipe Berlins, in welcher entgleiste Literaten sich damit begnügten,<br />
einander zum Spaß, den Philistern zum Trotz, überlauten und oft unsaubern<br />
Radau zu machen, selbst von Philisterei nicht unberührt. Leute von Namen,<br />
Ruge und Herwegh, waren entsetzt über das Treiben in der Kneipe; und<br />
der Symposiarch Bruno Bauer nahm es Stirner sehr übel, daß er über ihn<br />
hinausgegangen war.<br />
Stirners Buch konnte nicht werben für die Ideen des Verfassers, weil<br />
es dem eigenen engern Kreise unverständlich geblieben war, unverständlich<br />
bleiben mußte. Dieser Kreis berauschte sich — ganz ehrlich übrigens — an<br />
einigen Schlagworten, die von Frankreich (und von England) herübergekommen<br />
waren: politische Freiheit oder Republik, ökonomische Freiheit<br />
oder Kommunismus, religiöse Freiheit oder (ein sehr vorsichtiger) Atheis<br />
Stirner 213<br />
mus; die Ausdrucksform sehr oft nur ohnmächtige Wut gegen die Gewalthaber:<br />
die Fürsten, die Kapitalisten und die Hierarchie. Bis dann die kleine<br />
Revolution von 1848 der Wut ein wenig Luft machte. Und da wagte der<br />
unbekannte Oberlehrer Johann Caspar Schmidt es, sich auszuschütten vor<br />
Lachen über diese drei Liberalismen, über die Republikaner, die sich von<br />
ihrem Staate erst recht binden lassen wollten, über die Proletarier, die<br />
bürgerliche Lumpen werden wollten, vor allem aber über den Abgott der<br />
religiösen Freidenkerei, über Feuerbach, der den alten Gott zu einem Geschöpfe<br />
der Menschen gemacht hatte, sofort aber an die Stelle des abgesetzten<br />
Gottes eine neue Gottheit stellte, einen neuen Spuk, den es in<br />
der Welt der Wirklichkeiten nicht gab, den Menschen. Man muß sich darauf<br />
besinnen, welche Rolle die Abstraktion „der Mensch" in der Anthropologie<br />
Feuerbachs spielte, eigentlich auch darin, wie Bruno Bauer die Entstehung<br />
der Evangelien auf Massentradition zurückführte (obgleich da die individuelle<br />
Tätigkeit der Evangelisten nicht vergessen wurde), um nachzufühlen,<br />
welchen Schrecken Stirner mit seiner Lehre vom Einzigen erregen mußte.<br />
In diesem Punkte hatte er eine starke sprachkritische Leistung vollbracht, wie<br />
durch eine Explosion. Er hat weder hier noch sonst die Selbstsucht gepredigt,<br />
den sogenannten Egoismus; hat er doch das Sollen überhaupt geleugnet.<br />
Er hat nur, ungleich stärker als je ein Nominalist des Mittelalters, irgendeine<br />
Bedeutung von Allgemeinbegriffen abgelehnt, hat nur den Individuen<br />
Wirklichkeit zugesprochen (sprachlich wundervoll nur dem einzigen Ich),<br />
hat mit einer weit ausgreifenden Sense niedergemäht, was an Begriffen<br />
von Staat, Gesellschaft, Recht, Sitte und nebenbei auch von Religion<br />
hoch in Halmen stand. Niemand hat die Pflicht (übrigens gibt es keine<br />
Pflichten), über seinen eigenen Schatten zu springen. Nur ein Narr dürfte<br />
Stirner darum tadeln, daß er, der das Eine brennend nahe sah, das Andere<br />
gar nicht bemerkte: den wirklichen, unbewußten, ererbten, oft nützlichen<br />
Zusammenhang zwischen dem Einzigen und den übrigen Mit-Einzigen.<br />
Gewiß, Stirner war ein Monomane; besessen wie ein Prophet oder wie<br />
ein Künstler von seiner Eingebung, von seiner Sehnsucht nach freier Aussicht,<br />
wollte er alle Mauern der Tradition stürzen, die im Wege standen;<br />
und weil er keine anderen Mittel besaß als sein Ich, darum rannte er die<br />
Mauern mit seinem Kopfe nieder. Dieselben Tröpfe, die Nietzsche für<br />
unser Geschlecht unschädlich machen wollen durch den Hinweis auf seinen<br />
späteren Wahnsinn, mögen auch über Stirner lächeln und wohlweise<br />
flüstern: "Seine Mutter wurde ja wohl verrückt."<br />
Mit Bedacht habe ich gesagt, unter den Begriffen, die Stirner wie<br />
tote Götzen umgestürzt habe, seien nebenbei die der Religion gewesen.<br />
Stirner war so frei, in der Bekämpfung der Religion keine Lebensaufgabe