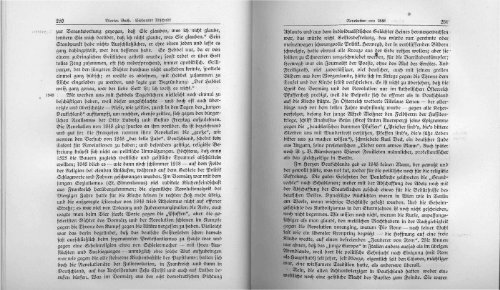Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
260 Viertes Buch. Siebenter Abschnitt<br />
zur Verantwortung gezogen, daß Sie glauben, was ich nicht glaube,<br />
sondern Sie mich darüber, daß ich nicht glaube, was Sie glauben." Sein<br />
Standpunkt habe nichts Ausschließliches, er ehre einen jeden und lasse es<br />
ganz dahingestellt, wer den besseren habe. So Hebbel nur, da er von<br />
einem zudringlichen Geistlichen gestellt wurde; sonst redet er über Gott<br />
tolles Zeug zusammen, oft sich widersprechend, immer apodiktisch. Grillparzer,<br />
der den jüngeren Dichter durchaus nicht ausstehen konnte, spottete<br />
einmal ganz hübsch; er wollte es ablehnen, mit Hebbel zusammen zu<br />
Tische eingeladen zu werden, und sagte zur Begründung: "Der Hebbel<br />
weiß ganz genau, wer der liebe Gott ist; ich weiß es nicht."<br />
1848 Wir werden uns mit Hebbels Tagebüchern vielleicht noch einmal zu<br />
beschäftigen haben, weil dieser ungeschlachte — und doch oft auch überreizte<br />
und überschätzte —Riese, wie zeitlos, zuerst in den Tagen des „jungen<br />
Deutschland" aufstampft, um nachher, ebenso zeitlos, sich gegen den bürgerlichen<br />
Realismus der Otto Ludwig und Gustav Freytag aufzulehnen.<br />
Die Revolution von 1848 ging spurlos an ihm vorüber. Es ist bezeichnend<br />
und gut so: die Franzosen nennen ihre Revolution die "große", wir<br />
nennen den Versuch von 1848 „das tolle Jahr". Deutschland, scheint kein<br />
Talent für Revolutionen zu haben; und besonders geistige, religiöse Befreiung<br />
knüpft sich nicht an politische Umwälzungen. Höchstens, daß anno<br />
1525 die Bauern zugleich weltliche und geistliche Tyrannei abschütteln<br />
wollten; 1848 blieb es —wie dann noch schlimmer 1918 — auf dem Felde<br />
der Religion bei elenden Anläufen, während auf dem Gebiete der Politik<br />
Schlagworte und Fahnen geschwungen wurden. Im Vormärz war mit dem<br />
jungen Sozialismus (Saintsimonismus) viel radikale Kirchenfeindschaft<br />
aus Frankreich herübergekommen; die eigentliche Revolutionslyrik der<br />
Vierziger Jahre hatte für die Kirche keinen so rechten Haß mehr übrig,<br />
und die aufgeregte Literatur von 1848 trieb Atheismus nicht auf offener<br />
Straße; es war viel von Toleranz und Judenemanzipation die Rede, auch<br />
wagte man beim Bier starke Worte gegen die „Pfaffen", aber die gefeiertsten<br />
Dichter des Vormärz und der Revolution schienen im Kampfe<br />
gegen die Throne den Kampf gegen die Altäre vergessen zu haben. Vielleicht<br />
war das darin begründet, daß das deutsche Geistesleben schon damals<br />
fast ausschließlich beim sogenannten Protestantismus zu Hause war und<br />
gegen eine Scheinreligion etwa von Schleiermacher — mit ihren Ausflüchten<br />
und Ausbiegungen —unmöglich eine solche Wut aufzubringen<br />
war wie gegen die alte steinerne Kirchenbastille des Papsttums; hatten sich<br />
doch die Revolutionäre der Julirevolution, in Frankreich und dann in<br />
Deutschland, auf das Urchristentum Jesu Christi und auch auf Luther berufen<br />
dürfen. Was im Vormärz aus der echt demokratischen Dichtung<br />
Revolution von 1848 261<br />
Uhlands und aus dem individualistischen Gelächter Heines herausgewachsen<br />
war, das wurde nicht Geistesbefreiung, das wurde nur gereimte oder<br />
meinetwegen schwungvolle Politik. Herwegh, der in verblüffenden Bildern<br />
schwelgte, hatte einmal alle Kreuze aus der Erde reißen wollen; aber sie<br />
sollten zu Schwertern umgeschmiedet werden, für die Barrikadenkämpfer;<br />
Herwegh war ein Journalist der Poesie, ohne den Mut des Ernstes. Und<br />
Freiligrath, viel zuverlässiger, viel deutscher, auch mit seinen grellen<br />
Bildern aus dem Morgenlande, hätte sich im Kriege gegen die Throne dem<br />
Teufel und der Kirche selbst verschrieben. Es ist nicht zu übersehen, daß die<br />
Lyrik des Vormärz und der Revolution nur im katholischen Österreich<br />
Pfaffenhaß predigt, weil die Despotie sich da offener als in Deutschland<br />
auf die Kirche stützte. In Österreich wetterte Nikolaus Lenau — der allerdings<br />
noch vor dem tollen Jahre wahnsinnig wurde — gegen alle Ketzerverfolger,<br />
besang der junge Alfred Meißner den Feldherrn der Hussitenkriege,<br />
schliff Anastasius Grün (Graf Anton Auersperg) seine Epigramme<br />
gegen die "heuchlerischen dummen Pfaffen" ("Priester sind's, die's bittere<br />
Sterben uns mit Wundertrost versüßen, Pfaffen sind's, die's süße Leben<br />
bitter uns zu machen wissen"), schmiedete Karl Beck, ein deutscher Jude<br />
aus Ungarn, seine proletarischen "Lieder vom armen Mann". Auch später<br />
noch ist z. B. Kürnbergers Wiener Feuilleton männlicher, protestantischer<br />
als das gleichzeitige in Berlin.<br />
Im Herzen Deutschlands gab es 1848 keinen Mann, der gewußt und<br />
der gewollt hätte, was not tut, weder für die politische noch für die religiöse<br />
Befreiung. Die guten Gelehrten der Paulskirche zeichneten die "Grundrechte"<br />
nach Schablonen; weder mit der Abschaffung des Adels noch mit<br />
der Abschaffung der Staatskirchen geschah etwas für die Bedürfnisse des<br />
deutschen Volkes. Dynastische Rücksichten waren in Wien wie in Berlin<br />
am Werke, wenn wichtige Beschlüsse gefaßt wurden. Und die Geheimgeschichte<br />
des Katholizismus in den Sturmjahren ist noch nicht geschrieben,<br />
noch nicht begonnen. Wir wissen noch nicht, warum die Kurie, anpassungsfähiger<br />
als man glaubt, den weltlichen Machthabern in der Nachgiebigkeit<br />
gegen die Revolution voranging, warum Pio Nono — nach seiner Wahl<br />
fast wie ein liberaler Kronprinz begrüßt — die Hoffnung auf eine freie<br />
Kirche weckte, auf einen befreienden "Zauberer von Rom". Wir können<br />
nur ahnen, daß das "junge Europa" in Italien anders aussah als im übrigen<br />
Abendlande, weil dort die politische Sehnsucht nach Einigung (mit Rom<br />
als Hauptstadt) seit jeher, seit Rienzo, eigentlich seit den Cäsaren, mächtiger<br />
war, eine wirksamere Tradition hatte, als anderswo überall.<br />
Nein, die alten Achtundvierziger in Deutschland hatten weder eine<br />
weltliche noch eine geistliche Macht des Papstes zum Feinde. Sie waren