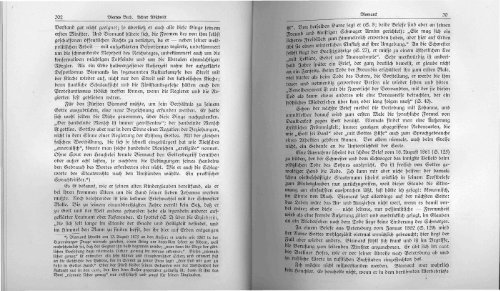Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
302 Viertes Buch. Achter Abschnitt<br />
Verstand gar nicht geeignet; so überließ er auch alle diese Dinge seinem<br />
ersten Minister. Und Bismarck hütete sich, die Formen des von ihm selbst<br />
geschaffenen öffentlichen Rechts zu verletzen, da er — neben seiner weltpolitischen<br />
Arbeit — mit aufgeklärtem Despotismus regierte, unbekümmert<br />
um die schwankende Mehrheit des Reichstages, unbekümmert auch um die<br />
konservativen mächtigen Todfeinde und um die liberalen ohnmächtigen<br />
Nörgler. Als ein Erbe halbvergessener Kaiserzeit nahm der aufgeklärte<br />
Despotismus Bismarcks im sogenannten Kulturkampfe den Streit mit<br />
der Kirche wieder auf, nicht nur den Streit mit der katholischen Kirche;<br />
denn staatliche Schulaufsicht und die Zivilstandsgesetze hätten auch den<br />
Protestantismus tödlich treffen können, wenn die Regierer und die Regierten<br />
fest geblieben wären.<br />
Für den Fürsten Bismarck müßte, um sein Verhältnis zu seinem<br />
Gotte auszudrücken, eine neue Bezeichnung erfunden werden. Er hatte<br />
sich wohl selten die Muhe genommen, über diese Dinge nachzudenken.<br />
"Der handelnde Mensch ist immer gewissenlos"; der handelnde Mensch<br />
ist gottlos. Gottlos aber nur in dem Sinne einer Negation der Beziehungen,<br />
nicht in dem Sinne einer Negierung der Existenz Gottes. Mit der gleichen<br />
falschen Wortbildung, die sich so schnell eingebürgert hat wie Nietzsches<br />
"amoralisch", könnte man solche handelnde Menschen "areligiös" nennen.<br />
Ohne Spur von Heuchelei konnte Bismarck den Gottesbegriff bemühen<br />
oder außer acht lassen, je nachdem die Bedingungen seines Handelns<br />
den Gebrauch des Wortes erforderten oder nicht. Wie er auch die Schlagworte<br />
des Staatsrechts nach den Umständen wählte. Ein praktischer<br />
Sprachkritiker.*)<br />
Es ist bekannt, wie er seinen alten Kinderglauben bereitfand, als er<br />
bei ihren frommen Eltern um die Hand seiner lieben Johanna werben<br />
mußte. Noch belehrender ist sein intimer Briefwechsel mit der Schwester<br />
Malle. Bis zu seinem einunddreißigsten Jahre verrät kein Satz, daß er<br />
zu Gott und der Welt anders gestanden habe als irgendein anderer aufgeklärter<br />
Leutnant oder Referendar. Er spottet (S. 2) über die Erzieherin,<br />
„die sich seit lange im Stande der Gnade und Heiligkeit befindet, und<br />
im Himmel den Mann zu finden hofft, der ihr hier auf Erden entgangen<br />
*) Bismarck schreibt am 13. August 1875 an den Kaiser: er würde wie 1867 in der<br />
Luxemburger Frage niemals zureden, einen Krieg um deswillen sofort zu führen, weil<br />
wahrscheinlich sei, daß der Gegner ihn bald beginnen werde; "man kann die Wege der göttlichen<br />
Vorsehung dazu niemals sicher genug im voraus erkennen." Dieses "niemals<br />
sicher genug" ist entweder ein sehr kühner und blasphemischer Scherz und erinnert fast<br />
an die Geschichte des Pastors, der in Seenot zu seiner Frau sagt: "Hier sind wir gar zu<br />
sehr in Gottes Hand." Oder der Fürst kleidet seinen Gedanken von der Unsicherheit der<br />
Zukunft nur in den cant, der ihm dem Kaiser gegenüber geläufig ist; dann ist ihm das<br />
Wort "niemals sicher genug" nur entschlüpft und zeugt für seinen Unglauben.<br />
Bismarck 303<br />
ist". Von derselben Dame sagt er (S. 8; beide Briefe sind aber an seinen<br />
Freund und künftigen Schwager Arnim gerichtet): "Sie mag sich ein<br />
sicheres Freibillett zum Himmelreich erworben haben, aber hier auf Erden<br />
übt sie einen winterlichen Einfluß auf ihre Umgebung." An die Schwester<br />
selbst klagt der Dreißigjährige (S. 27), er müsse zu einem ästhetischen Tee<br />
"mit Lektüre, Gebet und Ananasbowle". Sehr merkwürdig ist anderthalb<br />
Jahre später ein Brief, der ganz deutlich beweist, er glaube nicht<br />
an ein Jenseits. Beim Tode der Freundin erschüttert ihn zum ersten Male,<br />
viel stärker als beim Tode des Vaters, die Vorstellung, er werde die ihm<br />
teuer und notwendig gewordene Person nie wieder sehen und hören.<br />
"Beneidenswert ist mir die Zuversicht der Verwandten, mit der sie diesen<br />
Tod als kaum etwas anderes wie eine Vorausreise betrachten, der ein<br />
fröhliches Wiedersehen über kurz oder lang folgen muß" (S. 40).<br />
Schon der nächste Brief meldet die Verlobung mit Johanna, und<br />
unmittelbar darauf wird zum ersten Male die sprachliche Formel von<br />
Dankbarkeit gegen Gott benützt. Niemals findet man eine Äußerung<br />
christlicher Frömmigkeit; immer genügen abgegriffene Redensarten, die<br />
wie "Gott sei Dank" oder "mit Gottes Hilfe" auch zum Sprachgebrauche<br />
eines Atheisten gehören können. Vor allem niemals, auch beim Greise<br />
nicht, ein Gedanke an die Unsterblichkeit der Seele.<br />
Eine Ausnahme scheint der schöne Brief vom 16. August 1861 (S. 125)<br />
zu bilden, der der Schwester und dem Schwager das innigste Beileid beim<br />
plötzlichen Tode des Sohnes ausspricht. Da ist freilich von Gottes gewaltiger<br />
Hand die Rede. Ich kann mir aber nicht helfen: der damals<br />
schon vielbeschäftigte Staatsmann scheint wirklich in seinem Trostbriefe<br />
zum Kinderglauben nur zurückzugreifen, weil dieser Glaube die Stimmung<br />
am einfachsten aussprechen läßt, fast hätte ich gesagt: ökonomisch,<br />
im Sinne von Mach. Bismarck sagt allerdings auf der nächsten Seite:<br />
das Leben wäre das An- und Ausziehen nicht wert, wenn es damit vorbei<br />
wäre; aber diese — nicht seltene, nur pessimistische — Frommheit<br />
wird als eine fremde Äußerung zitiert und ausdrücklich gesagt, im Glauben<br />
an ein Wiedersehen nach dem Tode liege keine Linderung des Schmerzes.<br />
In einem Briefe aus Petersburg vom Januar 1862 (S. 129) wird<br />
der Name Gottes wohlgezählt viermal unnützlich gebraucht; hier liegt der<br />
Fall aber wieder anders. Bismarck fühlt sich krank und ist im Begriffe,<br />
die Berufung zum leitenden Minister anzunehmen. Er übt sich im cant<br />
des Berliner Hofes, wie er vor seiner Abreise nach Petersburg ab und<br />
zn russische Worte un russischen Buchstaben eingeflochten hat.<br />
Ich möchte nicht mißverstanden werden. Bismarck war wahrlich<br />
kein Heuchler. Er heuchelte nicht, wenn er in dem berühmten Werbebriefe