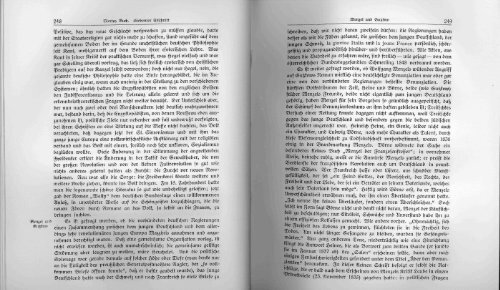Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
248 Viertes Buch. Siebenter Abschnitt<br />
Positive, das das neue Geschlecht versprechen zu müssen glaubte, hatte<br />
mit der Staatsreligion gar nichts mehr zu schaffen, stand ungefähr auf dem<br />
gemeinsamen Boden der im Grunde unchristlichen deutschen Philosophie<br />
seit Kant, wohlgemerkt auf dem Boden ihrer esoterischen Lehre. Was<br />
Kant in seiner Kritik der praktischen Vernunft, was Hegel vielfach und was<br />
gar Schelling überall vortrug, das ließ sich freilich exoterisch von christlichen<br />
Predigern auf der Kanzel selbst verwenden; doch nicht nur Hegel, nein, die<br />
gesamte deutsche Philosophie hatte eine Linke herangebildet, die im Unglauben<br />
einig war, wenn auch uneinig in der Stellung zu den verschiedenen<br />
Systemen; ähnlich hatten die Enzyklopädisten von den englischen Deisten<br />
den Indifferentismus und die Toleranz allein gelernt und sich um die<br />
erkenntnistheoretischen Fragen nicht weiter bemüht. Der Unterschied aber,<br />
der nun nach zwei oder drei Menschenaltern jetzt deutlich wahrzunehmen<br />
war, bestand darin, daß die Enzyklopädisten, von denen Rousseau eben auszunehmen<br />
ist, politische Ziele nur nebenher und fast unbewußt verfolgten,<br />
bei ihren Schriften an eine Wirkung auf die Masse nicht dachten, das Volk<br />
verachteten, daß dagegen jetzt der St. Simonismus und mit ihm das<br />
ganze junge Europa eine volkswirtschaftliche Aufklärung mit der religiösen<br />
verband und das Volk mit einem, freilich noch sehr unklaren, Sozialismus<br />
beglücken wollte. Diese Änderung in der Stimmung der angreifenden<br />
Freidenker erklärt die Änderung in der Taktik der Gewalthaber, die von<br />
der großen Revolution und von der kleinen Julirevolution so gut wie<br />
nichts anderes gelernt hatten als Furcht: die Furcht vor neuen Revolutionen.<br />
Neu war also die Sorge: die Freidenkerei könnte weitere und<br />
weitere Kreise ziehen, könnte ins Volk dringen. Im 18. Jahrhundert hatte<br />
man die sogenannte schöne Literatur so gut wie unbehelligt gelassen; jetzt<br />
gab der Roman "Wally" dem deutschen Bundestage einen willkommenen<br />
Anlaß, in unerhörter Weise auf die Schöngeister loszuschlagen, die die<br />
neuen Ideen durch Romane an das Volk, ja selbst an die Frauen, zu<br />
bringen suchten.<br />
Menzel und Es ist gefragt worden, ob die verbündeten deutschen Regierungen<br />
Gutzkow einen Zusammenhang zwischen dem jungen Deutschland und dem allerdings<br />
sehr revolutionären jungen Europa Mazzinis annahmen und anzunehmen<br />
berechtigt waren. Daß eine gemeinsame Organisation vorlag, ist<br />
nicht erwiesen worden, ist auch unwahrscheinlich; die gemeinsame geistige<br />
Strömung aber leugnen zu wollen, wäre Heuchelei. Und die politische<br />
Spionage war gerade damals auf solcher Höhe oder Tiefe (man denke nur<br />
an die Tätigkeit des preußischen Generalpostmeisters Nagler, der „so vollkommen<br />
Briefe öffnen konnte", daß er dafür geadelt wurde), das junge<br />
Deutschland hatte nach der Schweiz und nach Frankreich so viele Briefe zu<br />
Menzel und Gutzkow 249<br />
schreiben, daß wir nicht daran zweifeln dürfen: die Regierungen haben<br />
besser als wir die Fäden gekannt, die zwischen dem jungen Deutschland, der<br />
jungen Schweiz, la giovine Italia und la jeune France persönlich, schöngeistig<br />
und propagandistisch hinüber- und herüberführten. Alle Akten, aus<br />
denen die Wahrheit zu erfahren wäre, sind freilich — wie gesagt — von dem<br />
österreichischen Bundestaggesandten Schmerling 1848 verbrannt worden.<br />
Es ist weiter gefragt worden, ob Wolfgang Menzels wütender Angriff<br />
auf Gutzkows Roman wirklich eine beabsichtigte Denunziation war oder gar<br />
eine von den verbündeten Regierungen bestellte Denunziation. Die<br />
stärksten Volkstribunen der Zeit, Heine und Börne, beide (wie Gutzkow)<br />
früher Menzels Freunde, beide nicht eigentlich zum jungen Deutschland<br />
gehörig, haben Menzel für sein Vorgehen so gründlich ausgepeitscht, daß<br />
der Schimpf des Denunziantentums an ihm haften geblieben ist; Treitschkes<br />
Versuch einer Rettung konnte dagegen nicht aufkommen, weil Treitschke<br />
gegen das junge Deutschland und besonders gegen die beiden jüdischen<br />
Außenseiter ungerecht war. Heinrich Heine, ein Genie, leider nicht auch<br />
ein Charakter, und Ludwig Börne, noch mehr Charakter als Talent, durch<br />
diese Wesensungleichheit zu Todfeindschaft vorherbestimmt, waren 1836<br />
einig in der Brandmarkung Menzels. Börne widmete der Sache ein<br />
besonderes kleines Buch "Menzel der Franzosenfresser"; in vornehmer<br />
Weise, beinahe ruhig, weist er die Anwürfe Menzels zurück; er preist die<br />
Verdienste der französischen Revolution auch um Deutschland in prunkvollen<br />
Sätzen. Wer Frankreich hasse oder lästere, aus schnöder Dienstgefälligkeit,<br />
der sei "ein Feind Gottes, der Menschheit, des Rechts, der<br />
Freiheit und der Liebe, der sei ein Verräter an seinem Vaterlande, welches<br />
auch sein Vaterland sein möge". Heftig wird Börne erst, da er Menzels<br />
Unverschämtheit erwähnen muß, der ihn einen Überläufer genannt hatte.<br />
„Ich nenne ihn keinen Überläufer, sondern einen Überschleicher." Doch<br />
selbst im Zorn sagt Börne nicht und denkt nicht daran, Menzel der Käuflichkeit<br />
zu beschuldigen; nur Eitelkeit, Schwäche und Unverstand habe ihn zu<br />
einem offiziösen Kotsassen gemacht. Wie andere vorher. „Ohnmächtig, sich<br />
die Freiheit des Lebens zu gewinnen, flüchteten sie in die Freiheit des<br />
Todes. Um nicht länger Gefangene zu bleiben, wurden sie Gefängniswärter."<br />
Aus ganz anderem Tone, niederträchtig wie eine Hinrichtung<br />
klingt die Antwort Heines, die als Vorwort zum dritten <strong>Band</strong>e (er sandte<br />
sie im Januar 1837 ab) des "Salon" erscheinen sollte, dann aber nach<br />
einigen Zensurschwierigkeiten gesondert unter dem Titel „Über den Denunzianten"<br />
herauskam. In dieser kleinen Schrift befolgt er selbst die Ratschläge,<br />
die er bald nach dem Erscheinen von Menzels Kritik Laube in einem<br />
Privatbriefe (23. November 1835) gegeben hatte: in politischen Fragen