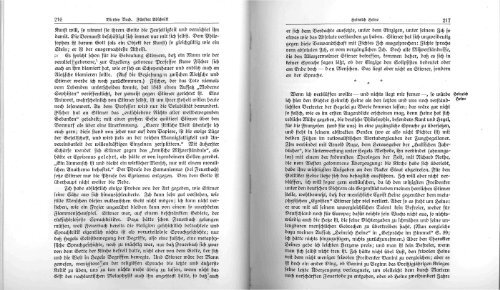Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
21 6 Viertes Buch. Fünfter Abschnitt<br />
Kunst will, so nimmt sie ihrem Gotte die Jenseitigkeit und vernichtet ihn<br />
damit. Die Vernunft beschäftigt sich immer nur mit sich selbst. Dem Philosophen<br />
ist darum Gott (als ein Objekt der Kunst) so gleichgültig wie ein<br />
Stein; er ist der ausgemachteste Atheist.<br />
Es spricht schon für die Bedeutung Stirners, daß ein Mann wie der<br />
veraltet geborene, zur Exzellenz geborene Professor Kuno Fischer sich<br />
auch an ihm blamiert hat, wie er sich an Schopenhauer und endlich auch an<br />
Nietzsche blamieren sollte. (Auf die Beziehungen zwischen Nietzsche und<br />
Stirner werde ich noch zurückkommen.) Fischer, der das Tote niemals<br />
vom Lebenden unterscheiden konnte, hat 1848 einen Aufsatz "Moderne<br />
Sophisten" veröffentlicht, der zumeist gegen Stirner gerichtet ist. Eine<br />
Antwort, wahrscheinlich von Stirner selbst, ist um ihrer Hoheit willen heute<br />
noch lesenswert. An dem Professor wird nur die Volubilität bewundert.<br />
Fischer hat an Stirner das „entschiedene Nichts aller weltbewegenden<br />
Gedanken" getadelt; mit einer großen Geste quittiert Stirner über den<br />
Vorwurf als über eine Anerkennung. "Euere sittliche Welt überlasse ich<br />
euch gern; diese stand von jeher nur auf dem Papiere, ist die ewige Lüge<br />
der Gesellschaft, und wird stets an der reichen Mannigfaltigkeit und Unvereinbarkeit<br />
der willenkräftigen Einzelnen zersplittern." Mit äußerster<br />
Schärfe wendet sich Stirner gegen das „komische Mißverständnis", als<br />
hätte er Egoismus gelehrt, als hätte er von irgendeinem Sollen geredet.<br />
"Ein Unmensch ist und bleibt ein wirklicher Mensch, nur mit einem moralischen<br />
Anathema behaftet." Der Phrase des Humanismus (bei Feuerbach)<br />
setze Stirner nur die Phrase des Egoismus entgegen. Von dem Gotte ist<br />
überhaupt nicht weiter die Rede.<br />
Ich habe absichtlich einige Proben von der Art gegeben, wie Stirner<br />
seine Sätze aus sich hinausschleuderte. Ich kann sehr gut verstehen, wie<br />
stille Menschen diesen vulkanischen Geist nicht mögen; ich kann nicht verstehen,<br />
wie ein Freier ungerührt bleiben kann von einem so unerhörten<br />
Flammenschauspiel. Stirner war, auf einem beschränkten Gebiete, der<br />
rücksichtsloseste Sprachkritiker. Dazu hätte schon Feuerbach gelangen<br />
müssen, weil Feuerbach bereits die Religion geschichtlich betrachtete und<br />
Sprachkritik eigentlich nichts ist als vorurteilslose Sprachgeschichte; nur<br />
daß Hegels Selbstbewegung der Begriffe, also eine falsche, eine metaphysische<br />
Sprachgeschichte, noch zu mächtig war, nur daß Feuerbach sich zwar<br />
von dem Gotte der Kirche befreit hatte, nicht aber von dem Gotte, der sich<br />
und die Welt in Hegels Begriffen bewegte. Und Stirner wäre der Mann<br />
gewesen, wenigstens an der religiösen Sprache die letzte und äußerste<br />
Kritik zu üben, uns zu tun nichts mehr übrig zu lassen, wenn nicht das<br />
Gift der nachkantischen Metaphysik auch ihn angesteckt hätte, so daß auch<br />
Heinrich Heine 217<br />
er sich dem Verdachte aussetzte, unter dem Einzigen, unter seinem Ich so<br />
etwas wie das Absolute verstanden zu haben. Stirner hat sich unzweideutig<br />
gegen diese Verwandtschaft mit Fichtes Ich ausgesprochen: Fichte spreche<br />
vom absoluten Ich, er vom vergänglichen Ich. Doch alle Mißverständnisse,<br />
die den Alleszermalmer Stirner betreffen, kommen daher, daß es sich in<br />
keiner Sprache sagen läßt, ob der Einzige den Solipsisten bedeutet oder<br />
am Ende doch — den Menschen. Das liegt aber nicht an Stirner, sondern<br />
an der Sprache.<br />
Wenn ich verblüffen wollte — und nichts liegt mir ferner —, so würde Heinrich<br />
ich hier den Dichter Heinrich Heine als den letzten und uns noch verständlichsten<br />
Vertreter der Hegelei zu Worte kommen lassen; das wäre gar nicht<br />
so falsch, wie es im ersten Augenblicke erscheinen mag, denn Heine hat sich<br />
redliche Mühe gegeben, die deutsche Philosophie, besonders Kant und Hegel,<br />
für die Franzosen (und für uns) in eine zugängliche Sprache zu übersetzen,<br />
und steht in seinem abstrakten Denken (wo er also nicht Dichter ist) mit<br />
beiden Füßen im rationalistischen Wortaberglauben der Junghegelianer.<br />
Ihn verbindet mit Arnold Ruge, dem Herausgeber der „Hallischen Jahrbücher",<br />
die Unterwerfung unter Hegels Methode, ihn verbindet (ahnungslos)<br />
mit einem der frömmsten Theologen der Zeit, mit Richard Rothe,<br />
die vom Westen gekommene Überzeugung: die Kirche habe sich überlebt,<br />
habe ihre wichtigsten Aufgaben an den Racker Staat abgetreten. Für den<br />
Politiker Heine ließe sich das behaglich ausführen. Ich will aber nicht verblüffen,<br />
ich will sogar gern enttäuschen, da ich den witzigsten Freidenker<br />
unter den deutschen Dichtern als Gegenstück neben meinen herrlichen Stirner<br />
stelle, wohlbewußt, daß der menschliche Egoist Heine gegenüber dem metaphysischen<br />
"Egoisten" Stirner sehr viel verliert. Aber so es steht um Heine:<br />
er war mit all seinem unvergleichlichen Talent kein Befreier, weder für<br />
Deutschland noch für Europa; dafür reichte sein Wuchs nicht aus, so nichtswürdig<br />
auch die Hetze ist, die seine Dichtergaben zu schmähen und seine unleugbaren<br />
menschlichen Gebrechen zu übertreiben sucht. (Man vergleiche<br />
dazu meinen Aufsatz "Heinrich Heine" in "Gespräche im Himmel" S. 59;<br />
ich hätte nichts hinzuzufügen, nichts zurückzunehmen.) Aber den Charakter<br />
Heines gebe ich leichten Herzens preis; und man ist kein Befreier, wenn<br />
man sich selbst nicht treu ist. Ich hätte nicht übel Lust, den frivolen Heine<br />
mit dem nicht weniger frivolen Freidenker Vanini zu vergleichen; aber es<br />
ist doch ein ander Ding, ob Vanini zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges<br />
seine letzte Überzeugung verleugnete, um vielleicht dem durch Martern<br />
noch verschärften Feuertode zu entgehen, oder ob Heine zweihundert Jahre