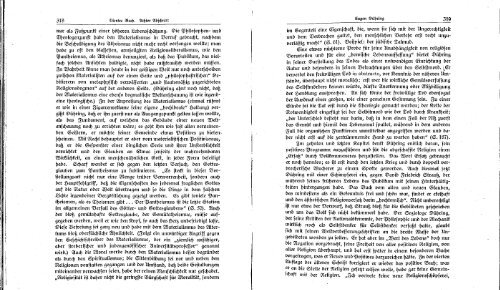Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
318 Viertes Buch. Achter Abschnitt<br />
nur als Fußpunkt einer höheren Lebensschätzung. Die Philosophen- und<br />
Theologenzunft habe den Materialismus in Verruf gebracht, nachdem<br />
die Beschuldigung des Atheismus nicht mehr recht verfangen wollte; man<br />
habe zu oft den blassesten, armseligsten Religionsliberalismus, wie den<br />
Pantheismus, als Atheismus denunziert, als daß das Publikum, das vielfach<br />
solchen Ansichten huldigte, nicht habe mißtrauisch werden müssen.<br />
In Wahrheit könne man heute in der geistigen Welt nur noch unterscheiden<br />
zwischen Materialisten auf der einen Seite und "philosophastrischen" Debitierern<br />
von metaphysisch verwässerten „und staatsmäßig zugerichteten<br />
Religionsdogmen" auf der anderen Seite. (Dühring ahnt noch nicht, daß<br />
der Materialismus eine ebenso dogmatische Weltanschauung ist wie irgendeine<br />
theologische.) In der Anpreisung des Materialismus (einmal rühmt<br />
er wie in einer Zigarrenreklame seine eigene „hochideale" Haltung) vergißt<br />
Dühring, daß er ihn zuerst nur als Ausgangspunkt gelten lassen wollte,<br />
als das Fundament, auf welchem das Gebäude einer neuen Weltanschauung<br />
noch zu errichten wäre; es geht ihm wie fast allen verneinenden<br />
Geistern, er möchte seiner Gemeinde etwas Positives zu bieten<br />
scheinen. Mit Recht behauptet er aber vom materialistischen Positivismus,<br />
daß er die Gespenster einer dinglichen Seele und ihrer Unsterblichkeit<br />
vernichtet und den Glauben an Etwas jenseits der wahrnehmbaren<br />
Wirklichkeit, an einen menschenähnlichen Gott, in jeder Form beseitigt<br />
habe. Scharf wendet er sich gegen den letzten Versuch, den Gottesglauben<br />
zum Pantheismus zu sublimieren. „Es steckt in dieser Vorstellungsart<br />
nicht nur eine Menge trüber Verworrenheit, sondern auch<br />
der Hauptfehlgriff, daß die Eigenschaften des jedesmal fraglichen Gottes<br />
auf die Natur oder Welt übertragen und so die Dinge in dem falschen<br />
Lichte irgendeiner Vergöttlichung gezeigt werden. Es gibt soviele Pantheismen,<br />
als es Theismen gibt . . . Der Pantheismus ist die letzte Station<br />
im allgemeinen Verfall des Götter- und Gottesglaubens" (S. 50). Auch<br />
der bloß gemütshafte Gottesglaube, der Gemütstheismus, müsse aufgegeben<br />
werden, weil er wie den Kopf, so auch das Herz unbefriedigt lasse.<br />
Diese Befreiung sei ganz neu und habe mit dem Materialismus des Altertums<br />
bloß oberflächliche Ähnlichkeit. (Folgt ein unwürdiger Angriff gegen<br />
den Geschichtschreiber des Materialismus, der ein „ziemlich unfähiger,<br />
aber streberischer und judengenössischer Universitätsprofessor" genannt<br />
wird.) Auch die Moral werde durch den Materialismus besser begründet<br />
als durch den Spiritualismus; die Sittenbildung sei vor und neben den<br />
Religionen vonstatten gegangen und der Umstand, daß beide Gestaltungen<br />
miteinander verwachsen seien, habe der reinen Menschlichkeit nur geschadet.<br />
"Religiosität ist daher nicht die geringste Bürgschaft für Moralität, sondern<br />
Eugen Dühring 319<br />
im Gegenteil eine Eigenschaft, die, wenn sie sich mit der Ungerechtigkeit<br />
und dem Verbrechen gattet, den menschlichen Verkehr erst recht unzuverlässig<br />
macht" (S. 61). Beispiel: der jüdische Talmud.<br />
Eine etwas nüchterne Probe für seine Unabhängigkeit von religiösen<br />
Vorurteilen und für eine "heroische Lebensauffassung" bietet Dühring<br />
in seiner Darstellung des Todes als einer notwendigen Einrichtung der<br />
Natur und besonders in seinen Betrachtungen über den Selbstmord. Er<br />
bewertet den freiwilligen Tod in abstracto, vor Kenntnis der näheren Umstände,<br />
überhaupt nicht moralisch; erst wer die wirkliche Gemütsverfassung<br />
des Selbstmörders kennen würde, dürfte Anerkennung oder Mißbilligung<br />
der Handlung aussprechen. An sich könne der freiwillige Tod ebensogut<br />
der Ausdruck einer großen, wie einer gemeinen Gesinnung sein. Zu einer<br />
Sünde sei die Tat erst durch die Theologie gemacht worden; der Kette der<br />
Notwendigkeit eingefügt sei der Selbstmord wie der Tod durch Krankheit;<br />
„der Unterschied besteht nur darin, daß in dem einen Fall der Riß zuerst<br />
das Gemüt und hiemit den Lebensmut spaltet, während in dem anderen<br />
Fall die organischen Funktionen unmittelbar angegriffen werden und daher<br />
nicht erst auf die zertrümmernde Hand zu warten haben" (S. 187).<br />
Im zehnten und letzten Kapitel denkt Dühring endlich daran, sein<br />
positives Programm auszuführen und für die abgeschaffte Religion einen<br />
„Ersatz" durch Vollkommeneres herzustellen. Das Wort Ersatz gebraucht<br />
er noch harmlos; es ist erst durch den letzten Krieg und durch doppelt verbrecherische<br />
Wucherer zu einem Spotte geworden. Auch diesmal setzt<br />
Dühring mit einer Schimpferei ein, gegen David Friedrich Strauß, der<br />
während seines früheren Lebens das Publikum mit seinen Hinterhältigkeiten<br />
hintergangen habe. Das Buch vom alten und neuen Glauben,<br />
das mindestens als ein Bekenntnis frei und schön war, findet er ekelhaft<br />
und den ästhetischen Religionsersatz darin „hochkomisch". Nicht unberechtigt<br />
ist nur etwa der Vorwurf, daß Strauß bloß für die Gebildeten geschrieben<br />
und um das Volk sich nicht bekümmert habe. Der Soziologe Dühring,<br />
der seine Kritiken der Nationalökonomie, der Philosophie und der Mechanik<br />
wirklich noch als Selbstdenker für Selbstdenker verfaßt hatte, glaubt<br />
sich mit seinen Weltverbesserungsschriften an die breite Masse der Ungebildeten<br />
wenden zu sollen. Er hat aber im „Wert des Lebens" doch nur<br />
die Negation vorgebracht, seine Freiheit von aller positiven Religion, von<br />
aller Religion überhaupt, und hat erst später in einem besonderen Buche<br />
vorgetragen, was er Neues und Positives darzureichen hätte. In der vierten<br />
Auflage der älteren Schrift korrigiert er wieder das positive Buch; was<br />
er an die Stelle der Religion gesetzt wissen wolle, habe gar keine Gemeinschaft<br />
mit der Religion. "Ich vertrete keine neue Religionsschöpferei,