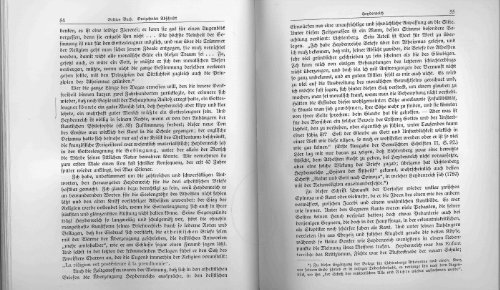Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
54<br />
Drittes Buch. Dreizehnter Abschnitt<br />
denken, es ist eine leidige Ziererei; er kann sie gut für einen Augenblick<br />
vergessen, denn sie entgeht ihm nicht . . . Die höchste Reinheit der Gesinnung<br />
ist nur für den Gottesleugner möglich, und nur über die Trümmer<br />
der Religion geht man sicher jenem Ideale entgegen, sie muß vernichtet<br />
werden, damit nicht alle moralische Güte ein bloßer Traum sei . . . Ja,<br />
gesetzt auch, es wäre ein Gott, so müßte er sich den moralischen Wesen<br />
verbergen, müßte, wenn nicht die ganze Bestimmung derselben verloren<br />
gehen sollte, mit den Prinzipien der Sittlichkeit zugleich auch die Prinzipien<br />
des Atheismus gründen."<br />
Wer die ganze Länge des Weges ermessen will, den die innere Denkfreiheit<br />
binnen kurzen zwei Jahrhunderten zurücklegte, der erinnere sich<br />
wieder, daß noch Bayle mit der Behauptung Anstoß erregt hatte, ein Gottesleugner<br />
könnte ein guter Mensch sein, daß Heydenreich aber klipp und klar<br />
lehrte, ein wahrhaft guter Mensch müßte ein Gottesleugner sein. Und<br />
Heydenreich ist völlig in seinem Rechte, wenn er von den Anhängern der<br />
Kantischen Philosophie (S. 58) Zustimmung fordert; dieser neue Ton<br />
des Ernstes war wirklich bei Kant in die Schule gegangen; der englische<br />
Deismus hatte sich beinahe nur auf eine Kritik des Christentums beschränkt,<br />
die französische Freigeisterei war wesentlich materialistisch; Heydenreich sah<br />
in der Gottesleugnung die Bedingung, unter der allein der Mensch<br />
die Würde seiner sittlichen Natur bewahren könnte. Wir vernehmen da<br />
zum ersten Male einen Ton fast schriller Konsequenz, der erst 40 Jahre<br />
später wieder anklingt, bei Max Stirner.<br />
Ich habe, unbekümmert um die zahlreichen und schwerfälligen Antworten,<br />
den Herausgeber Heydenreich für die drei atheistischen Briefe<br />
haftbar gemacht. Ich glaube dazu berechtigt zu sein, weil Heydenreich es<br />
an bewundernden Worten für die Seelengröße des Atheisten nicht fehlen<br />
läßt und den alten Kniff vorsichtiger Atheisten anwendet: der Sieg der<br />
Religion werde vollendet sein, wenn die Gottesleugnung sich auch in ihrer<br />
stärksten und glänzendsten Rüstung nicht halten könne. Seine Gegengründe<br />
trägt Heydenreich so langweilig und schulgemäß vor, stört die ohnehin<br />
mangelhafte Kunstform seines Briefwechsels durch so lederne Noten und<br />
Beilagen, daß der Eindruck sich verstärkt, die atheistischen Briefe seien<br />
mit der Wärme der Überzeugung geschrieben, die deistischen Antworten<br />
"mehr amtshalber", wie er am Schlusse sogar einen Freund sagen läßt.<br />
Und selbst in der letzten der frömmelnden Beilagen führt er den Satz des<br />
Zweiflers Charron an, der die Tugend immerhin der Religion voranstellt:<br />
"La réligion est postérieure à la preudhomie".<br />
Auch die Zeitgenossen waren der Meinung, daß sich in den atheistischen<br />
Briefen die Überzeugung Heydenreichs ausspräche, in den deistischen<br />
Heydenreich<br />
Einwürfen nur eine unaufrichtige und schwächliche Anpassung an die Sitte.<br />
Unter diesen Zeitgenossen ist ein Mann, dessen Stimme besondere Beachtung<br />
verdient: Lichtenberg. Sein Urteil ist Wort für Wort zu überlegen.<br />
"Ich habe Heydenreichs Briefe über den Atheismus gelesen, und<br />
ich muß bekennen, daß mir, seiner Absicht zuwider, die Briefe des Atheisten<br />
sehr viel gründlicher geschrieben zu sein scheinen als die des Gläubigen.<br />
Ich kann mich von einigen Behauptungen des letzteren schlechterdings<br />
nicht überzeugen, und doch bin ich mit Anstrengungen der Vernunft nicht<br />
so ganz unbekannt, und an gutem Willen fehlt es mir auch nicht. Es wird<br />
zu viel auf die Ausbreitung des moralischen Bewußtseins gerechnet und,<br />
ich möchte fast sagen, sich hinter diesen Satz versteckt, um einem glauben zu<br />
machen, man sei moralisch krank, wenn man die Behauptung nicht versteht.<br />
Hätten die Erfinder dieser wohlgemeinten Sätze anerkannte Infallibilität,<br />
so könnte man sich gewöhnen, ihre Sätze wahr zu finden, und sie könnten<br />
von ihrer Seite sprechen: dein Glaube hat dir geholfen. — Aber was ist<br />
für den Menschen ein solcher Beweis der Existenz Gottes und der Unsterblichkeit,<br />
den zu verstehen, oder eigentlich zu fühlen, unter Tausenden kaum<br />
einer fähig ist? Soll der Glaube an Gott und Unsterblichkeit wirklich in<br />
einer Welt wie diese nützen, so muß er wohlfeiler werden oder er ist so viel<br />
wie gar keiner." (Erste Ausgabe der Vermischten Schriften II, S. 82.)<br />
Hier lag mir nur daran zu zeigen, daß Lichtenberg zwar eine bewußte<br />
Absicht, dem Atheisten Recht zu geben, bei Heydenreich nicht voraussetzte,<br />
aber eine solche Wirkung der Briefe zugab; übrigens hat Lichtenberg<br />
Heydenreichs "System der Ästhetik" gekannt, wahrscheinlich auch dessen<br />
Schrift "Natur und Gott nach Spinoza", in welcher Heydenreich sich (1789)<br />
mit der Naturreligion auseinandersetzte.*)<br />
In dieser Schrift schwankt der Verfasser wieder unklar zwischen<br />
Spinoza und Kant oder vielmehr, da er die Ideen des einen wie des andern<br />
verwässert, zwischen Jacobi und einem unähnlichen Kantbilde. Es war<br />
wie immer. Unter den Gegnern Kants waren viele Pedanten, die seines<br />
Geistes keinen Hauch verspürt hatten; doch etwas Pedanterie auch bei<br />
denjenigen Gegnern, die doch in der Hauptfrage, in der erkenntniskritischen,<br />
als Skeptiker noch schärfer sahen als Kant. Und unter seinen Anhängern<br />
verrieten ihn aus Ehrgeiz und falscher Klugheit gerade die besten Köpfe,<br />
während so kleine Denker wie Heydenreich wenigstens in einem Nebenpunkte<br />
die Meinung ihres Meisters trafen. Heydenreich war das Enfant<br />
terrible des Kritizismus, Fichte war der Musterknabe der neuen Schule;<br />
*) Zu dieser Ergänzung der Belege für Lichtenbergs Atheismus noch einen. Kurz<br />
vor seinem Ende schrieb er in ruhiger Todessehnsucht, es verlange ihn nach dem Augenblick,<br />
wo ihn "der Schoß des mütterlichen Alls und Nichts wieder aufnehmen werde".<br />
55