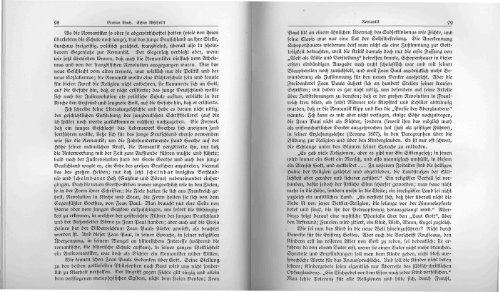Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
98 Viertes Buch. Erster Abschnitt<br />
Als die Romantiker so oder so abgewirtschaftet hatten (viele von ihnen<br />
überlebten die Schule noch lange), trat das junge Deutschland an ihre Stelle,<br />
durchaus freigeistig, politisch gerichtet, französelnd, überall also in scheinbarem<br />
Gegensatze zur Romantik. Der Gegensatz verblaßt aber, wenn<br />
wir jetzt übersehen können, daß auch die Romantiker vielfach vom Atheismus<br />
und von der französischen Revolution ausgegangen waren. Was das<br />
neue Geschlecht vom alten trennte, war wirklich nur die Politik und der<br />
neue Sozialismus; die Romantik wollte eine Dichterschule sein und konnte<br />
für diesen Zweck die Religion nicht entbehren, sie klammerte sich an Gott,<br />
auf die Gefahr hin, daß er nicht existierte; das junge Deutschland wollte<br />
sich nach der Julirevolution als politische Schule auftun, erblickte in der<br />
Kirche den Erzfeind und leugnete Gott, auf die Gefahr hin, daß er existierte.<br />
Ich schreibe keine Literaturgeschichte und habe es darum nicht nötig,<br />
der geschichtlichen Entstehung der jungdeutschen Schriftstellerei (auf die<br />
ich später noch werde zurückkommen müssen) nachzugehen. Die Formel,<br />
daß ein junges Geschlecht das Lebenswerk Goethes sich aneignen und<br />
fortführen wollte, ließe sich für das junge Deutschland ebenso verwenden<br />
wie für die Romantik; um die Jahrhundertwende stand Goethe auf der<br />
Höhe seiner männlichen Kraft, die Romantik vergötterte ihn, nur daß<br />
die Unterwerfung mit der Zeit zum Aufstande führen mußte und führte;<br />
bald nach der Julirevolution starb der Greis Goethe und auch das junge<br />
Deutschland wagte es, ein Erbe des großen Deutschen anzutreten, diesmal<br />
das des großen Heiden; nur daß jetzt scheinbar innigstes Verständnis<br />
und scheinbarer Haß (Gutzkow und Börne) nebeneinander einhergingen.<br />
Doch die neuen Goethe-Erben waren ungoethisch wie in den Zielen,<br />
so in der Form ihrer Schriften; die Ziele hatten sie sich aus Frankreich geholt,<br />
Revolution in Kirche und Staat, die Form holten sie sich von dem<br />
Gegenfüßler Goethes, von Jean Paul. Man braucht nur eine Seite von<br />
Börne oder vom jungen Gutzkow aufzuschlagen, um sofort die Abhängigkeit<br />
zu erkennen, in welcher der geistreichste Führer des jungen Deutschland<br />
und der Außenseiter Börne zu Jean Paul standen; aber auch auf die Prosa<br />
Heines hat der Bilderreichtum Jean Pauls stärker gewirkt, als beachtet<br />
worden ist. Und dieser Jean Paul, in seiner Sprache, in seiner religiösen<br />
Überzeugung, in seinem Mangel an historischem Interesse (während die<br />
romantische, die historische Schule aufkam), in seiner ganzen Weltlichkeit<br />
ein Antiromantiker, war doch als Dichter ein Romantiker wider Willen.<br />
Wir kennen schon Jean Pauls Gedanken über Gott. Seine Stellung<br />
zu den beiden gottlosesten Philosophen nach Kant wird uns nicht sonderlich<br />
zu Klarheit verhelfen. Der Angriff gegen Fichte gilt einzig und allein<br />
dem verstiegenen metaphysischen System, nicht dem freien Denken; Jean<br />
Romantik 99<br />
Paul litt an einem ähnlichen Übermaß des Subjektivismus wie Fichte, und<br />
seine Clavis war nur eine Tat der Selbstbefreiung. Die Anerkennung<br />
Schopenhauers wiederum darf man nicht als eine Zustimmung zur Gottlosigkeit<br />
betrachten, weil die Kritik damals doch nur die erste Fassung von<br />
"Welt als Wille und Vorstellung" betreffen konnte, Schopenhauer in dieser<br />
ersten einbändigen Ausgabe noch recht scholastisch war und mit seinen<br />
Blasphemien noch zurückhielt, und weil Jean Paul ausdrücklich mehr Bewunderung<br />
als Zustimmung für den neuen Denker ausspricht. Aber die<br />
Freidenkerei Jean Pauls äußert sich an hundert Stellen seiner krausen<br />
Schriften; wir haben es gar nicht nötig, uns besonders auf seine Urteile<br />
über Zeitströmungen zu berufen; daß er der großen Revolution in Frankreich<br />
treu blieb, als selbst Männer wie Klopstock und Schiller abtrünnig<br />
wurden, daß er die Romantik klipp und klar die „Poesie des Aberglaubens"<br />
nannte. Ich kann es mir aber nicht versagen, einige Sätze nachzutragen,<br />
die Jean Paul nicht als Dichter, sondern (soweit ihm das möglich war)<br />
als wissenschaftlicher Denker ausgesprochen hat (just als geistiger Führer),<br />
in seiner Erziehungslehre (Levana 1807), in den Paragraphen über die<br />
Bildung zur Religion und über den Kinderglauben. Es ist nur oft schwer,<br />
die Schlange unter den Blumen seiner Sprache zu entdecken.<br />
"Es gab viele Religionen, aber es gibt nur Ein Sittengesetz; in jenen<br />
wird immer ein Gott ein Mensch, und also mannigfach umhüllt, in diesem<br />
ein Mensch Gott, und entkleidet ... In unserem Zeitalter sind die heiligen<br />
Haine der Religion gelichtet und abgetrieben, die Landstraßen der Sittlichkeit<br />
aber gerader und sicherer geführt." Ein religiöser Verfall sei vorhanden,<br />
dafür jedoch der sittliche Sinn schärfer geworden; man baue nicht<br />
mehr in die Höhe, sondern mehr in die Weite; ein irreligiöses Land sei nicht<br />
zugleich ein unsittliches Land. "Es versteht sich, daß hier überall nicht die<br />
Rede ist von jener Bettler-Religion, die so lange vor der Himmelspforte<br />
betet und singt, bis ihr der Petruspfennig herausgelangt wird." Allerdings<br />
folgt darauf eine mystische Phantasie über den "Laut Gott", über<br />
den Urfreund; Fénelon wird zitiert, ein Kind, Weib, Mann, Engel zugleich.<br />
Wie sei nun das Kind in die neue Welt hineinzuführen? Nicht durch<br />
Beweise für die Existenz Gottes. Aber auch die Vorschrift Rousseaus, den<br />
Kindern erst im reiferen Alter von Gott zu reden, sei bedenklich; sie erfahren<br />
da von einem Vater erst, wenn sie einen Vater nicht mehr brauchen.<br />
Symbole und Empfindungen soll man dem Kinde geben, nicht bloß aussprechliche<br />
Worte für das Unaussprechliche. Und soll die Kinder nicht beten<br />
lehren; Kindergebete seien eigentlich nur Überreste des jüdisch-christlichen<br />
Opferglaubens. „Ein Tischgebet vor dem Essen muß jedes Kind verfälschen."<br />
Man lehre Toleranz für alle Religionen und hüte sich, durch Furcht,