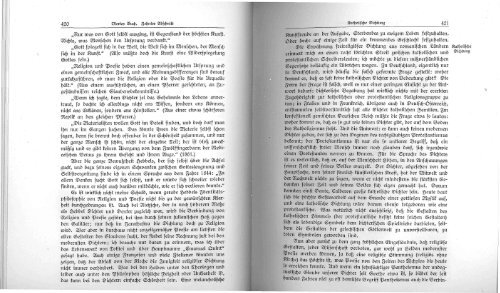Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
420 Viertes Buch. Zehnter Abschnitt<br />
"Nur was von Gott selbst ausging, ist Gegenstand der höchsten Kunst.<br />
Nichts, was Menschen den Ursprung verdankt."<br />
"Gott spiegelt sich in der Welt, die Welt sich im Menschen, der Mensch<br />
sich in der Kunst." (Also müßte doch die Kunst eine Widerspiegelung<br />
Gottes sein.)<br />
"Religion und Poesie haben einen gemeinschaftlichen Ursprung und<br />
einen gemeinschaftlichen Zweck, und alle Meinungsdifferenzen sind darauf<br />
zurückzuführen, ob man die Religion oder die Poesie für die Urquelle<br />
hält." (Aus einem ausführlichen, an einen Pfarrer gerichteten, an Zugeständnissen<br />
reichen Glaubensbekenntnisse.)<br />
"Wenn ich sagte, dem Dichter sei das Geheimnis des Lebens anvertraut,<br />
so dachte ich allerdings nicht ans Wissen, sondern ans Können,<br />
nicht ans Erklären, sondern ans Hinstellen." (Aus einer etwas schärferen<br />
Replik an den gleichen Pfarrer.)<br />
"Die Materialisten wollen Gott im Detail finden, und doch darf man<br />
ihn nur im Ganzen suchen. Das könnte ihnen die Materie selbst schon<br />
sagen, denn sie brennt doch offenbar in der Schönheit zusammen, und nur<br />
der ganze Mensch ist schön, nicht der einzelne Teil; der ist bloß zweckmäßig<br />
und es gibt keinen Übergang von dem Zwölffingerdarm der Mediceischen<br />
Venus zu ihrem Gesicht und ihrem Auge." (1861.)<br />
Aber die ganze Bewußtheit Hebbels, der sich selbst über die Achsel<br />
guckt, und dazu seinem eigenen Schwanken zwischen Gottesleugnung und<br />
Selbstvergottung finde ich in einem Spruche aus dem Jahre 1844: "In<br />
allem Denken sucht Gott sich selbst, und er würde sich schneller wieder<br />
finden, wenn er nicht auch darüber mitdächte, wie er sich verlieren konnte."<br />
Es ist wirklich nicht meine Schuld, wenn gerade Hebbels Identitätsphilosophie<br />
von Religion und Poesie nicht bis zu der gewünschten Klarheit<br />
durchgedrungen ist. Auch bei Nietzsche, der in noch höherem Maße<br />
als Hebbel Dichter und Denker zugleich war, wird die Verbindung von<br />
Religion und Poesie gestört, bei ihm durch seinen julianischen Haß gegen<br />
den Galiläer; nur daß im Zarathustra die Dichtung doch zu Religion<br />
wird. Wer aber in durchaus nicht unzeitgemäßer Poesie am liebsten die<br />
alten Gestalten des Glaubens sucht, der findet seine Rechnung just bei den<br />
modernsten Dichtern; ich brauche nur daran zu erinnern, was ich über<br />
das Lebenswerk von Tolstoi und über Hauptmanns „Emanuel Quint"<br />
gesagt habe. Auch einige Franzosen und viele Italiener könnten uns<br />
zeigen, daß der Abfall von der Kirche die Innigkeit religiöser Dichtung<br />
nicht immer verhindert. Was bei den Halben unter den Theologen und<br />
leider auch unter den Philosophen häßliche Feigheit oder Unklarheit ist,<br />
das kann bei den Dichtern einfache Schönheit sein. Eine melancholische<br />
Katholische Dichtung 421<br />
Kunstfreude an der Aufgabe, Sterbendes zu ewigem Leben festzuhalten.<br />
Oder doch: auf einige Zeit für ein kommendes Geschlecht festzuhalten.<br />
Die Erwähnung freireligiöser Dichtung aus romanischen Ländern Katholische<br />
erinnert mich an einen recht törichten Streit zwischen katholischen und<br />
protestantischen Schreibersleuten; ich möchte zu diesem mißverständlichen<br />
Gegensatze beiläufig ein Wörtchen wagen. In Deutschland, eigentlich nur<br />
in Deutschland, wird häufig die falsch geformte Frage gestellt: woher<br />
kommt es, daß es fast keine katholischen Dichter von Bedeutung gibt? Die<br />
Form der Frage ist falsch, weil es nur einer geringen Einsicht zu der Antwort<br />
bedarf: dichterische Begabung hat wirklich nichts mit der ererbten<br />
Zugehörigkeit zur katholischen oder protestantischen Religionsgruppe zu<br />
tun; in Italien und in Frankreich, übrigens auch in Deutsch-Österreich,<br />
entstammten selbstverständlich fast alle Dichter katholischen Familien. Im<br />
konfessionell gemischten Deutschen Reich müßte die Frage etwa so lauten:<br />
woher kommt es, daß es so gut wie keinen Dichter gibt, der auf dem Boden<br />
des Katholizismus steht. Und die Antwort: es kann auch keinen modernen<br />
Dichter geben, der sich zu den Dogmen des rechtgläubigen Protestantismus<br />
bekennt; der Protestantismus ist nur ein so unklarer Begriff, daß ein<br />
wissenschaftlich freier Mensch immer noch glauben darf, sich irgendwie<br />
einen Protestanten nennen zu können. Für die Sprache des Dichters<br />
ist es wesentlich, daß er, auf der Menschheit Höhen, in den Anschauungen<br />
seiner Zeit und seines Volkes wurzelt. Der Dichter, abgesehen von der<br />
Hauptsache, von seiner sinnlich künstlerischen Kraft, hat der Mitwelt und<br />
der Nachwelt nichts zu sagen, wenn er nicht mindestens die stärksten Gedanken<br />
seiner Zeit und seines Volkes sich eigen gemacht hat. Darum<br />
konnten einst Dante, Calderon große katholische Dichter sein. Heute baut<br />
sich die höchste Geistesarbeit auf dem Grunde einer gottlosen Mystik auf,<br />
und eine katholische Dichtung wäre darum ebenso totgeboren wie eine<br />
protestantische. Was natürlich nicht ausschließt, daß die Gestalten des<br />
katholischen Himmels (der protestantische besitzt keine solchen Gestalten)<br />
sich als lebendige Symbole dem dichterischen Spieltriebe darbieten, seitdem<br />
die Gestalten der griechischen Götterwelt zu unvorstellbaren, zu<br />
toten Symbolen geworden sind.<br />
Nun aber zurück zu dem ganz fröhlichen Eingeständnis, daß religiöse<br />
Gestalten, jeder Wissenschaft verboten, gar wohl zu Helden modernster<br />
Poesie werden können, ja daß eine religiöse Stimmung (religiös ohne<br />
Kirche) das Höchste ist, was Poesie von den Zeiten des Äschylos bis heute<br />
je erreichen konnte. Und wenn ein sehnsüchtiger Pantheismus der undogmatische<br />
Glaube unserer Dichter seit Goethe etwa ist, so bildet der seit<br />
hundert Jahren viel zu oft bemühte Begriff Pantheismus auch die Verbin