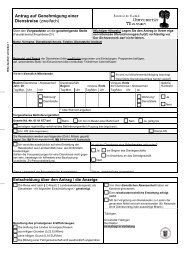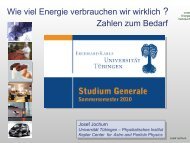Experimentalphysik III (Atomphysik)
Experimentalphysik III (Atomphysik)
Experimentalphysik III (Atomphysik)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5.7. Röntgenspektren, Auger–Effekt 101<br />
die einer starken Beeinflußung durch die chemischen Bindung unterliegen, beobachtet man bei<br />
Röntgenspektren eine begrenzte Zahl von Linien, die in einige Serien zusammengefaßt werden<br />
können. Diese Serien konvergieren zu einer kurzwelligen Grenze. Man bezeichnet die Serien mit<br />
K, L, M, N, ..., die Linien innerhalb der Serien mit griechischen Buchstaben beginnend mit α,<br />
d.h. z.B. die Linie des Übergangs von L nach K heißt K α –Linie, von M nach KK β –Linie (vgl.<br />
Abbildung 5.13). Moseley fand im Jahre 1913 ein einfaches Gesetz, das die Frequenzen der<br />
Spektrallinien mit der Ordnungszahl Z des emittierenden Elements verknüpft. Die erste Linie<br />
der K–Serie, die Linie Kα , kann in guter Näherung geschrieben werden als<br />
Kα : ν =(Z − σ Kα K ) 2 �<br />
1 1<br />
Rc −<br />
12 22 �<br />
Moseley: ν = Kα 3<br />
Rc(Z − 1)2<br />
4<br />
und für die erste Linie der L–Serie gilt<br />
Lα : ν =(Z − σ Lα L ) 2 �<br />
1 1<br />
Rc −<br />
22 32 �<br />
; Moseley: ν = Lα 5<br />
Rc(Z − 7.4)2<br />
36<br />
σ K ≈ 1<br />
σ L ≈ 7.4<br />
wobei σ die Abschirmungskonstante der jeweiligen Seriengrenze bedeutet. Die Übergänge zwischen<br />
inneren Schalen sind energiereicher als die Übergänge in äußeren Schalen.<br />
Kossel deutete 1916 die Entstehung der Röntgenlinienspektren anhand des Bohrschen Atommodells<br />
folgendermaßen: Zunächst muß das anregende Elektron ein Atomelektron aus einer<br />
inneren Schale entfernen. Das so entstandene Loch wird durch äußere Elektronen aufgefüllt.<br />
Für diese Auffüllung bestehen folgende Möglichkeiten:<br />
1. Ein Elektron fällt unmittelbar (d.h. unter Überspringen sämtlicher Zwischenstufen) in den<br />
freien Platz der inneren Elektronenbahnen zurück.<br />
2. Es findet ein stufenweises Zurückfallen statt.<br />
Zwischen diesen beiden Fällen gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Der Gesamtbetrag<br />
der freiwerdenden Energie muß aber beim direkten Übergang gleich sein, wie bei einer<br />
Übergangskaskade. Alle Übergänge, die auf der gleichen inneren Schale enden, treten gemeinsam<br />
auf. Sie bilden zusammen eine Serie.<br />
Damit wurde der Beweis der Schalenstruktur erbracht. Heute: Wichtiges Verfahren zur Z–<br />
Bestimmung (Materialanalyse).<br />
Z ählrate<br />
λ min<br />
K β<br />
K α<br />
Charakteristische<br />
Linien<br />
Bremskontinuum<br />
λ =2d sin ϑ<br />
Abb. 5.12: Charakteristisches Röntgenspektrum.<br />
Abb. 5.13: Schema zur Erklärung der K, L,<br />
M Serien im Röntgenspektrum, Übergänge<br />
von Elektronen aus äußeren Schalen nach der<br />
Ionisation (Erzeugung eines Loches in einer<br />
inneren Schale).