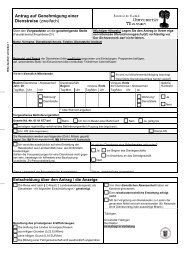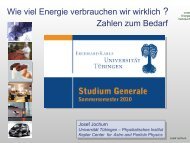Experimentalphysik III (Atomphysik)
Experimentalphysik III (Atomphysik)
Experimentalphysik III (Atomphysik)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
102 Kapitel 5. Das Atommodell nach Rutherford, Bohr, Sommerfeld<br />
Auger–Effekt<br />
K L<br />
N<br />
M<br />
Auger–<br />
Elektronen<br />
Abb. 5.14: Augerelektronenemission.<br />
Eine Konkurrenz zur Emission der charakteristischen<br />
Röntgenstrahlung stellt die Emission von Elektronen aus<br />
äußeren Schalen dar. Das Atom gibt seine hohe Anregungsenergie<br />
nicht in Form von elektromagnetischer<br />
Strahlung sondern in Form von Elektronen ab (Auger–<br />
Effekt); dadurch entsteht ein weiteres ” Loch“ in der Elektronenhülle.<br />
Auf diese Weise kann man hochionisierte<br />
Atome erhalten.<br />
Erklärung: Zunächst wird die K–Schale ionisiert. Ein<br />
L–Elektron fällt von der L– indieK–Schale und füllt die<br />
dort entstandene Lücke.<br />
Die frei werdende Energie wird benutzt, um ein zweites L–Elektron aus der L–Schale oder einer<br />
anderen zu entfernen, dieses entweicht aus dem Atom. Im Endeffekt ist die L–Schale also um<br />
zwei Elektronen ärmer geworden, diese werden wiederum von weiter außen liegenden Elektronen<br />
nachgeliefert. Somit kann es zur Emission weiterer Auger–Elektronen kommen. Für die<br />
kinetische Energie der Auger–Elektonen gilt<br />
E kin = hν Kα − E L = E K − E L − E L = E K − 2 · E L<br />
mit E K , E L : Bindungsenergie in der K, bzw.L–Schale.<br />
Man stellt fest, daß die Wahrscheinlichkeit für solche strahlungslose Konkurrenzprozesse zur<br />
Röntgenemission mit steigender Kernladungszahl stark abnimmt, d.h. daß bei leichten Atomen<br />
die Wahrscheinlichkeit der Emission von Auger–Elektronen steigt.<br />
1<br />
.5<br />
η<br />
20 40 60 80<br />
Z<br />
Abb. 5.15: η in Abhängigkeit<br />
der Ordnungszahl Z.<br />
Abbildung 5.15 stellt dies anschaulich dar; wobei η wie folgt<br />
definiert ist:<br />
η =<br />
Zahl der Röntgenlicht emittieren Atome<br />
Zahl der in K, L, ... ionisierten Atome .<br />
5.8 Anregung von Atomen durch Elektronenstoß<br />
Die Ergebnisse der Bohrschen Theorie, insbesondere die Tatsache der diskreten Energieniveaus<br />
im Atom, können experimentell überprüft werden. Diese Überprüfung sollte unabhängig von<br />
den optischen Ergebnissen sein und die richtige Wiedergabe der Spektren zur Folge haben. Eine<br />
Bestätigung bildet z.B. auch die Wiedergabe der Größe des Wasserstoff–Atoms und eine Messung<br />
der Ionisierungsenergie aus der Seriengrenze der Lyman–Serie.<br />
Davon unabhängige Experimente zur Untersuchung der Atomstruktur lassen sich mit Elektronen<br />
durchführen.<br />
Erste Untersuchungen der Wechselwirkung von Elektronen und Materie wurden bereits um 1890<br />
von Lenard durchgeführt. Er stellte fest, daß 50 keV–Elektronen eine 3 µm dicke Al–Folie<br />
(∼ 104 Atomschichten) bzw. 7 mm Luft bei Normalbedinungen mit ca. 80 % Wahrscheinlichkeit<br />
durchdringen. Für die Abschwächung eines Elektronenstrahls (Transmissionsexperiment) gilt<br />
das übliche Schwächungsgesetz (vgl. Kapitel 1.5). Sei N(x) die Anzahl der Teilchen am Ort x.