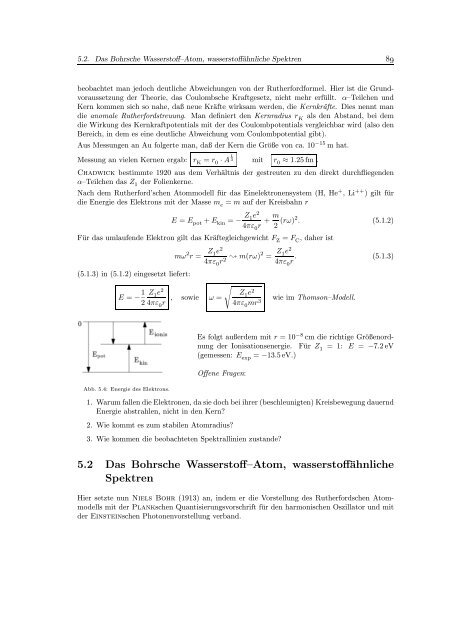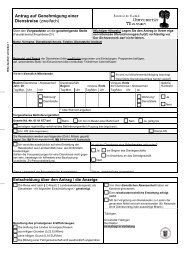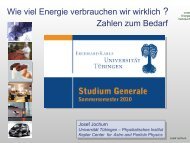Experimentalphysik III (Atomphysik)
Experimentalphysik III (Atomphysik)
Experimentalphysik III (Atomphysik)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5.2. Das Bohrsche Wasserstoff–Atom, wasserstoffähnliche Spektren 89<br />
beobachtet man jedoch deutliche Abweichungen von der Rutherfordformel. Hier ist die Grundvoraussetzung<br />
der Theorie, das Coulombsche Kraftgesetz, nicht mehr erfüllt. α–Teilchen und<br />
Kern kommen sich so nahe, daß neue Kräfte wirksam werden, die Kernkräfte. Dies nennt man<br />
die anomale Rutherfordstreuung. Man definiert den Kernradius rK als den Abstand, bei dem<br />
die Wirkung des Kernkraftpotentials mit der des Coulombpotentials vergleichbar wird (also den<br />
Bereich, in dem es eine deutliche Abweichung vom Coulombpotential gibt).<br />
Aus Messungen an Au folgerte man, daß der Kern die Größe von ca. 10−15 m hat.<br />
Messung an vielen Kernen ergab: r K = r 0 · A 1<br />
3 mit r 0 ≈ 1.25 fm .<br />
Chadwick bestimmte 1920 aus dem Verhältnis der gestreuten zu den direkt durchfliegenden<br />
α–Teilchen das Z 1 der Folienkerne.<br />
Nach dem Rutherford’schen Atommodell für das Einelektronensystem (H, He + ,Li ++ ) gilt für<br />
die Energie des Elektrons mit der Masse me = m auf der Kreisbahn r<br />
E = Epot + Ekin = − Z1e2 m<br />
+<br />
4πε0r 2 (rω)2 . (5.1.2)<br />
Für das umlaufende Elektron gilt das Kräftegleichgewicht FZ = FC , daher ist<br />
(5.1.3) in (5.1.2) eingesetzt liefert:<br />
Z 1 e 2<br />
E = − 1<br />
2 4πε0r Abb. 5.4: Energie des Elektrons.<br />
mω 2 r = Z1e2 4πε0r2 � m(rω)2 = Z1e2 . (5.1.3)<br />
4πε0r , sowie ω =<br />
�<br />
Z 1 e 2<br />
4πε 0 mr 3<br />
wie im Thomson–Modell.<br />
Es folgt außerdem mit r =10 −8 cm die richtige Größenordnung<br />
der Ionisationsenergie. Für Z 1 = 1 : E = −7.2eV<br />
(gemessen: E exp = −13.5eV.)<br />
Offene Fragen:<br />
1. Warum fallen die Elektronen, da sie doch bei ihrer (beschleunigten) Kreisbewegung dauernd<br />
Energie abstrahlen, nicht in den Kern?<br />
2. Wie kommt es zum stabilen Atomradius?<br />
3. Wie kommen die beobachteten Spektrallinien zustande?<br />
5.2 Das Bohrsche Wasserstoff–Atom, wasserstoffähnliche<br />
Spektren<br />
Hier setzte nun Niels Bohr (1913) an, indem er die Vorstellung des Rutherfordschen Atommodells<br />
mit der Plankschen Quantisierungsvorschrift für den harmonischen Oszillator und mit<br />
der Einsteinschen Photonenvorstellung verband.