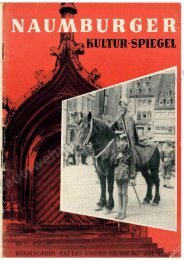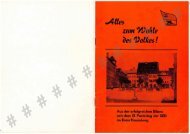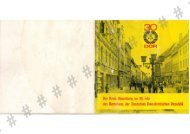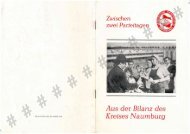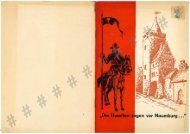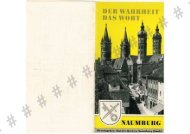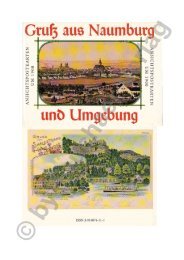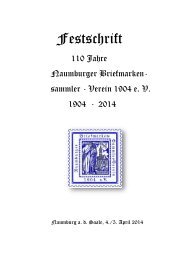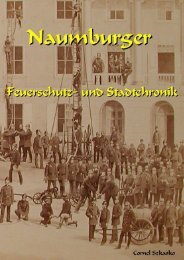Entwicklung des Kopfschutzes fuer den Feuerwehrmann
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Magirus plädierte damals aus Grün<strong>den</strong> der Sparsamkeit dafür, nur die Steiger, Retter und Chargierten<br />
mit Helmen auszurüsten, d.h. diejenigen, die durch ihre Funktion durch herabfallende Gegenstände<br />
gefährdet waren. Der Rest der Mannschaft sollte Feuerwehrmützen tragen. Auch das Nackenleder, wie<br />
es am Mannschaftshelm der Berliner Feuerwehr bereits üblich war, fand große Beachtung und Wertschätzung.<br />
In Norddeutschland und in der Schweiz wur<strong>den</strong> sogar gewöhnliche Helme hin und wieder<br />
mit solchen Nackenledern versehen. Magirus hatte schon 1877 das zuvor angenähte Nackenleder so<br />
hergestellt, dass dieses nach Bedarf am Helm oder an der Mütze befestigt bzw. entfernt wer<strong>den</strong> konnte.<br />
Die Chargen-Auszeichnungen, so war man damals der Ansicht, sollten auf das Nötigste beschränkt bleiben.<br />
Übertriebene Verzierungen wür<strong>den</strong> nicht dazu beitragen, die Autorität <strong>des</strong> Kommandieren<strong>den</strong> zu<br />
erhöhen oder das Ansehen <strong>des</strong> Korps bei der Bevölkerung zu steigern.<br />
Der Rosshaarbusch<br />
Den Kommandieren<strong>den</strong> sollte man, ohne langes Nachfragen, bei Tag und Nacht gut ausfindig machen<br />
können. Aufgrund dieser Überlegung wurde ca. 1850 der Rosshaarbusch eingeführt. Im damaligen Land<br />
Ba<strong>den</strong> wurde der Rosshaarbusch auch «Schwapp», in Offenburg «Wedel» genannt. Hatte der Betreffende<br />
eine durchschnittliche Körpergröße, so konnte man <strong>den</strong> Busch auf dem ganzen Brandplatz sehen und<br />
jeder der <strong>den</strong> «Buschträger» suchte, konnte auf ihn verwiesen wer<strong>den</strong>.<br />
Auf einer Fotografie vom 24. Mai 1857 der Stuttgarter Feuerwehr auf dem Schlossplatz sind bereits<br />
Helme mit Rosshaarbusch zu sehen.<br />
Helmbüsche gaben die taktische Stellung <strong>des</strong> Helmträgers (Funktionsbereich) zu erkennen, entarteten<br />
jedoch oft zum Statussymbol. Folgende Kennzeichnung war vorgesehen: Kommandant: weißer Rosshaarbusch<br />
(man vertrat die Meinung, dass nachts keine Farbe besser sichtbar war); Stellvertreter: weißrot<br />
(in Bayern rot); Abteilungskommandanten bei größeren Feuerwehren: rot seitlich; Hauptleute: rot<br />
seitlich; Oberleutnant: rot-weiß; Leutnant: rot; Requisitenmeister: schwarz; Spritzenmeister: rote, wollene<br />
Raupe seitlich.<br />
4. Lederhelme im Deutschen Reich – Einführung der Pickelhaube<br />
Die Militärhelme mussten konstant der wachsen<strong>den</strong> Effizienz der Waffen angepasst wer<strong>den</strong> und gelten<br />
so als bedeutende Sachzeugen militärtechnischer <strong>Entwicklung</strong>. Nebst Kopfschutz waren sie mit<br />
ihren Emblemen und Hoheitsabzeichen auch Symbol der Stan<strong>des</strong>- und Lan<strong>des</strong>zugehörigkeit und sind<br />
somit historische Zeugen der Kulturgeschichte gewor<strong>den</strong>. Zu Beginn <strong>des</strong> 19. Jahrhunderts hatte sich<br />
in fast allen europäischen Armeen der «Tschako» als Kopfbedeckung durchgesetzt und prägte auch in<br />
der preußischen Armee dreieinhalb Jahrzehnte lang das Erscheinungsbild der Soldaten. Entsprach der<br />
Tschako noch der damaligen allgemeinen Modeentwicklung – die zivile Kopfbedeckung war der Zylinder<br />
–, so hatte der am 23. Oktober 1842 neu eingeführte Lederhelm (mit Spitze) für die Truppen <strong>des</strong><br />
«Königreiches Preußen» ein recht eigenwilliges, geradezu martialisches Aussehen. Für die nächsten 75<br />
Jahre sollte dieser Helm zum Symbol <strong>des</strong> «preußisch-deutschen Militarismus» wer<strong>den</strong>. Da die Truppen<br />
nach wie vor mit umständlich zu handhaben<strong>den</strong> Vorderladergewehren ausgerüstet waren, musste dem<br />
Nahkampf wesentliche Bedeutung zugeschrieben wer<strong>den</strong>. Daher kam es in der Hauptsache darauf an,<br />
mit dem Helm Blankwaffen- und Kolbenhiebe abfangen und abgleiten lassen zu können. Kein Helmtyp<br />
konnte jedoch Schutz gegen feindliche Kugeln bieten.<br />
Die auf einem stabilen Kreuzblatt ruhende hohe Spitze <strong>des</strong> neuen Helmes verstärkte <strong>den</strong> Scheitelpunkt<br />
erheblich. Die breiten Schuppenketten, die Hinterschiene und nicht zuletzt das große Emblem <strong>des</strong> ledernen<br />
Helmes – heraldischer Adler mit <strong>den</strong> Buchstaben FR (Fridericus Rex) auf der Brust – machten ihn<br />
relativ hieb- und stichfest. Während sich der Tschako aus Filz bei Regen voll Wasser sog, unerträglich<br />
schwer wurde und im Gelände oft nur mit Mühe auf dem Kopf gehalten wer<strong>den</strong> konnte, so schützte<br />
nun die starke Lederglocke <strong>den</strong> Soldaten besser gegen Regen und auch Sonne. Die weit ausla<strong>den</strong><strong>den</strong><br />
30