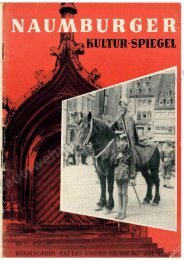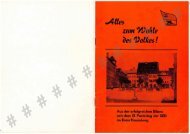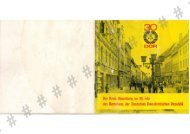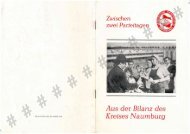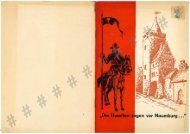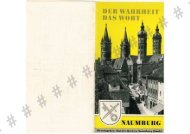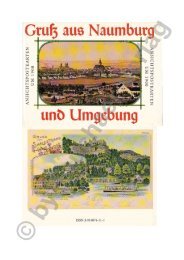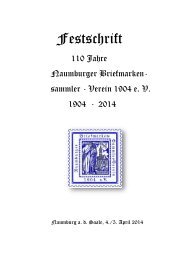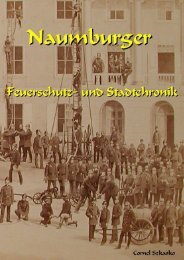Entwicklung des Kopfschutzes fuer den Feuerwehrmann
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
B. Verleihung wann, wo und an wen etc.) handelt es sich lediglich um ein historisch nahezu wertloses<br />
Anschauungsobjekt. Findet sich dagegen im Rahmen eines Nachlasses das vergleichsweise finanziell<br />
wertlose, da extrem häufige Exemplar in Bronze, dafür allerdings damit verbun<strong>den</strong> der dazugehörige<br />
rekonstruierbare historische Kontext (verliehen am soundsovielten an <strong>Feuerwehrmann</strong> Florian<br />
Mustergültig, seinerseits als Urenkel <strong>des</strong> Gründers in vierter Generation in derselben Wehr aktiv etc.),<br />
so stellt dieses Stück ein ungleich wertvolleres Zeitzeugnis der Feuerwehrgeschichte dar.<br />
Um ein historisches Objekt in seinen übergreifen<strong>den</strong> historischen Kontext zu stellen, hat sich die allgemeine<br />
Geschichtsforschung bis weit in die 2. Hälfte <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts nahezu ausschließlich der<br />
klassischen Archivalien (Akten, Briefe, Tagebuchaufzeichnungen, Zeitungsberichte, Filmdokumente<br />
und Fotografien) bedient. Bei <strong>den</strong> Tagebuchaufzeichnungen und Briefen setzt bereits eine Grauzone<br />
ein, in der sich die Überlieferungsform niederzuschlagen beginnt, die man im erweiterten Sind durchaus<br />
als ›Oral History‹ umreißen kann. Die Feuerwehrgeschichte hat sich ihrer bis heute leider kaum bedient<br />
und durch <strong>den</strong> zwischenzeitlichen Tod vieler potentieller Zeitzeugen sind wichtige historische Quellen<br />
unwiderruflich verloren.<br />
Feuerwehrgeschichte als Sondergebiet der Industriegeschichte<br />
Feuerwehrgeschichte stellt ein Sondergebiet der Industriegeschichte dar, die mit ihren umfangreichen<br />
zeit-, sozial- und kulturgeschichtlichen Aspekten weit über eine reine Technik- und Wirtschaftsgeschichte<br />
hinausreicht. Will sie als ernstzunehmende Forschungsdisziplin anerkannt wer<strong>den</strong>, so muss sie sich auch<br />
der adäquaten Methodik bedienen.<br />
An dieser Stelle kommen wir nicht umhin, <strong>den</strong> Begriff der ›Industriearchäologie‹ anzusprechen;<br />
diesbezüglich sei besonders verwiesen auf: Slotta Rainer, Einführung in die Industriearchäologie,<br />
Darmstadt 1982. Slotta (S. 150 ff.): »Nach dem Ende <strong>des</strong> Zweiten Weltkrieges stan<strong>den</strong> verständlicherweise<br />
der Aufbau und die Rekonstruktion der Kunst<strong>den</strong>kmäler in ihrer ganzen Vielfalt im Vordergrund<br />
der Bemühungen; außerdem beherrschte in <strong>den</strong> 40er, 50er und noch in <strong>den</strong> 60er Jahren das vom<br />
Nationalsozialismus geprägte „verherrlichende Bild <strong>des</strong> technikschaffen<strong>den</strong> Ingenieurs und mit der<br />
Technik ringen<strong>den</strong> deutschen Arbeiters“ die Vorstellung und stand der Dokumentation und Erhaltung<br />
technischer Denkmäler hinderlich im Wege. Lediglich vereinzelte technische Denkmäler, die in ganz<br />
besonderem Ausmaß mit ästhetischen Reizen versehen waren wie die Kranbauten an Rhein, Main und<br />
Mosel oder schlossähnliche Fabrikbauten erregten das Interesse der Denkmalpflege. […]« Slotta unterstreicht<br />
weiter: »[…], daß das Endziel der Industriearchäologie nicht das Objekt selbst sei, sondern<br />
dass sie durch Einbeziehung der materiellen Überreste in die Forschung zur Erkenntnis <strong>des</strong> Werdegangs<br />
der Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen habe. […] Die Bedeutung dieser Denkmäler muß in <strong>den</strong><br />
Kontext der Sozial- und Technikgeschichte gestellt wer<strong>den</strong>.« Der Begriff <strong>des</strong> Denkmals ist selbstre<strong>den</strong>d<br />
ebenso auf immobile (z. B. historische Feuerwachen) wie auf mobile (historische Kleinobjekte) anzuwen<strong>den</strong>;<br />
d. h. auch die Krawattennadel stellt in diesem Sinne ein Denkmal dar. Slotta zitiert hierzu Arthur<br />
Raistrick: »Industriearchäologie muß <strong>den</strong> arbeiten<strong>den</strong> Menschen erfassen, mit seinen Werkzeugen,<br />
Konstruktionen, Gebäu<strong>den</strong> und Rohstoffen, mit <strong>den</strong>en er arbeitet, und mit seiner unmittelbaren Umwelt,<br />
in welcher seine Arbeit ausgeführt wird.«<br />
Erweiterter Kulturbegriff / Neue Erfassungsmetho<strong>den</strong><br />
Die längst überfälligen gesellschaftlichen Umwälzungen in Folge der 68er-Bewegung führten auch zur<br />
Etablierung eines erweiterten Kulturbegriffes, der die Geschichte von ›Ottonormalverbraucher‹ inklusive<br />
der dinglichen Zeitzeugnisse seines soziokulturellen Umfel<strong>des</strong> als erhaltungswürdiges Kulturgut einstufte.<br />
Das Sammlungsprofil mancher Museen wurde entsprechend erweitert, zahlreiche neue Museen<br />
der Technik und Arbeit sowie Freilichtmuseen wur<strong>den</strong> eigens gegründet. Von <strong>den</strong> Sozialwissenschaften<br />
übernommene Befragungsmetho<strong>den</strong> inklusive der dazugehörigen Protokollierung etablierten sich<br />
schnell zur Ernst zu nehmen<strong>den</strong> historischen Quellengattung, fassten zunehmend als erweiterte<br />
338