5. Familienbericht 1999 - 2009 auf einen Blick - BMWA
5. Familienbericht 1999 - 2009 auf einen Blick - BMWA
5. Familienbericht 1999 - 2009 auf einen Blick - BMWA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FAMILIENBERICHT <strong>1999</strong> – <strong>2009</strong> AUF EINEN BLICK<br />
rende Effekte haben. Das trifft insbesondere <strong>auf</strong> das (zunehmend kommerzialisierte) Fernsehen<br />
zu („Fernsehsozialisation” – vgl. Boeckmann/Hipfl 1989). Damit schalten sich Medien<br />
und in besonderem Maße auch „Neue” Medien aktiv in die Prozesse der Rollenübernahme<br />
und Identitätsbildung von Kindern und Jugendlichen ein (Aufenanger 1990, Barthelmes/<br />
Sander 1990).<br />
Aufgrund der vorliegenden Forschungen können die sozialisierenden bzw. desozialisierenden<br />
Wirkungen der Neuen Medien (unter Einschluss der gesamten Games-Kultur) und<br />
ihr Einfluss <strong>auf</strong> das Familienleben nicht eindeutig beurteilt werden. Einerseits gibt es die<br />
Beobachtung, dass die intensive Nutzung derartiger Medien <strong>auf</strong> Dauer eine Einschränkung<br />
der Kontakte mit Familienmitgliedern und Freunden mit sich bringt und damit tendenziell<br />
zu sozialer Isolation führt (National Institute on Media and the Family). Andererseits wird<br />
<strong>auf</strong> das erzieherische und kreative Potenzial sowie <strong>auf</strong> die partizipative Struktur der neuen<br />
Medienkultur verwiesen (Gee 2003, Shaffer et al. 2005), die auch gesellschaftliche Verantwortung<br />
und Engagement fördern kann (Kahne/Middaugh/Evans 2008).<br />
Politische Sozialisation: Abgeschwächter „Generationentransfer”<br />
Politische Sozialisation vollzieht sich zu einem beträchtlichen Teil als „latente” Sozialisation,<br />
d. h. im Wege der im Kindes- oder Jugendalter stattfindenden Ausprägung einer spezifischen<br />
Persönlichkeitsstruktur, die bestimmte politische Haltungen begünstigt. So wird<br />
etwa von Christel Hopf (Hopf 1993) der Nachweis geführt, dass defizitäre Bindungsformen<br />
zwischen Kindern und deren primären Bezugspersonen zu einem problematischen Umgang<br />
mit Aggressionen führen, die sich in gewaltbejahenden und ethnozentrischen Orientierungen<br />
äußern können (s. Rippl 2008: 445 f.). Falls ein entsprechender Einfluss der<br />
Herkunftsfamilien für die Ausbildung politischer Einstellungen angenommen werden kann,<br />
müsste er sich im Generationentransfer politischer Zugehörigkeiten bzw. in der Bildung<br />
politischer Lager auswirken. Tatsächlich wurde die politische Landschaft Österreichs bis<br />
in die 1970er-Jahre hinein durch ausgeprägte Lagermentalitäten beschrieben, also eine<br />
Quasi-Vererbbarkeit von Politik über die Generationen. Die politische Entwicklung seit den<br />
1970er-Jahren ist durch eine weitgehende Erosion dieser politischen Lager gekennzeichnet<br />
(Naßmacher 2000: 22). Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass es <strong>einen</strong> derartigen<br />
Generationentransfer im Sinne einer „political transmission” in abgeschwächter Form nach<br />
wie vor gibt.<br />
Tabelle 16: Links-Rechts Positionierung (Angaben in Prozent)<br />
des Interviewten<br />
des<br />
Vaters<br />
der<br />
Mutter<br />
des besten<br />
Freundes<br />
sehr links 3 3 2 3<br />
links 19 18 19 15<br />
weder links noch rechts 46 28 34 35<br />
rechts 12 14 12 10<br />
sehr rechts 2 2 1 2<br />
trifft nicht zu 2 6 2 2<br />
weiß nicht 14 26 26 31<br />
Antwort verweigert 3 3 3 2<br />
108


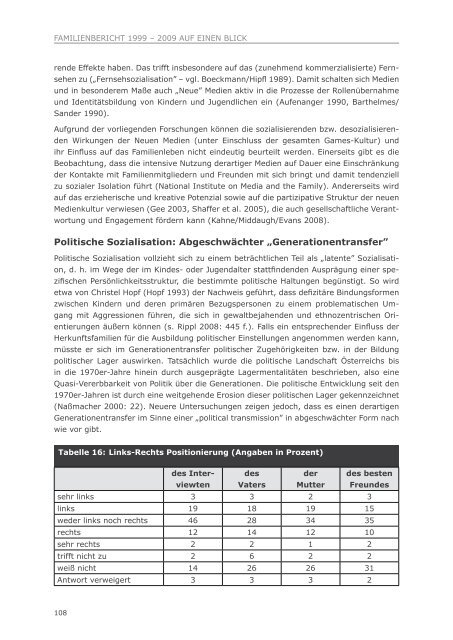








![Programmheft_Bambini.pdf [8264 KB] - OÃ Familienbund - beim ...](https://img.yumpu.com/30503392/1/190x138/programmheft-bambinipdf-8264-kb-oa-familienbund-beim-.jpg?quality=85)
![Zeitschrift Familie, Ausgabe Mai 2013 [PDF 4 MB] - Familienbund](https://img.yumpu.com/21088979/1/184x260/zeitschrift-familie-ausgabe-mai-2013-pdf-4-mb-familienbund.jpg?quality=85)
