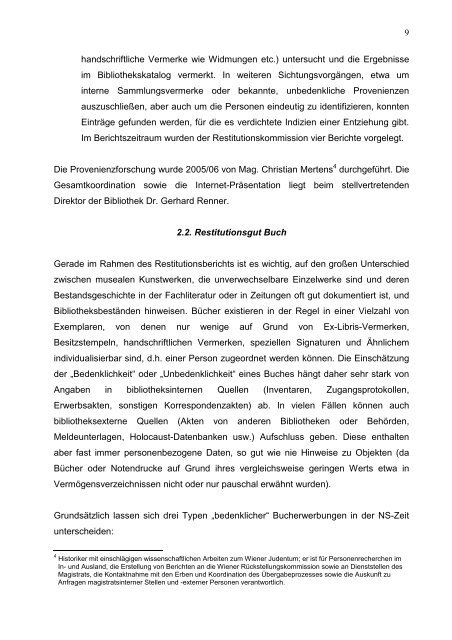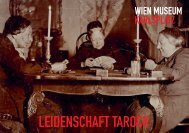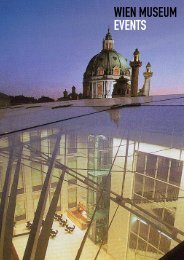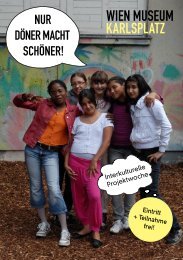- Seite 1 und 2: Wien, 1. Dezember 2006 An den Gemei
- Seite 3 und 4: 3.3. Restitution und Erbensuche in
- Seite 5 und 6: 1. Einleitung Nach der Machtüberna
- Seite 7: Objekte und die Suche nach den Erbe
- Seite 11 und 12: Juden mit Erlass vom 1. August 1940
- Seite 13 und 14: • Nach mehreren kleineren Deporta
- Seite 15 und 16: „Exemplarsatz“) eingetragen und
- Seite 17 und 18: Der erfahrne Baum-Küchen- und Blum
- Seite 19 und 20: Anm. zur Provenienz: möglicherweis
- Seite 21 und 22: Anm. zur Provenienz: möglicherweis
- Seite 23 und 24: Scheibe, Theodor: Die Studentenschw
- Seite 25 und 26: Petzold, Alfons: Menschen im Schatt
- Seite 27 und 28: Knödt, Heinrich: Zur Entwicklungsg
- Seite 29 und 30: 2.3.4.1. Zusammenfassender Bericht
- Seite 31 und 32: 135031 A. Winter: 1 Regieheft und 8
- Seite 33 und 34: 2.3.4.2. Zusammenfassender Bericht
- Seite 35 und 36: einem mit 1. August 1939 datierten
- Seite 37 und 38: In seinem Vermögensverzeichnis vom
- Seite 39 und 40: Titularprofessor ernannt. Von 1907
- Seite 41 und 42: zum 12. November 1938 auflistete, s
- Seite 43 und 44: Darüber hinaus steht ein Forum Int
- Seite 45 und 46: „herrenlosen“ Gütern seitens d
- Seite 47 und 48: 3. Museen der Stadt Wien 3.1. Über
- Seite 49 und 50: Von diesen „personenbezogenen“
- Seite 51 und 52: Auch die Zusammensetzung der Wiener
- Seite 53 und 54: verlieh in der Korrespondenz mit Re
- Seite 55 und 56: G. Redley, eine Restitution aus mor
- Seite 57 und 58: Nachdem es den Museen der Stadt Wie
- Seite 59 und 60:
Antwort ist bisher ausgeblieben. De
- Seite 61 und 62:
Gunsten des Landes Österreich (Rei
- Seite 63 und 64:
Da sich die Suche nach Rechtsnachfo
- Seite 65 und 66:
In ihrem ersten Kodizill vom 4. Jun
- Seite 67 und 68:
Gabriel Szamek starb am 19. April 1
- Seite 69 und 70:
Mag. Monika Wulz von der Anlaufstel
- Seite 71 und 72:
14. Meine Gattin stellt ebenfalls e
- Seite 73 und 74:
auch Zugang zum Atelier Malva Schal
- Seite 75 und 76:
Lisa Fittko brachte im Mai 2003 üb
- Seite 77 und 78:
Dieser Ehe entstammte eine Tochter,
- Seite 79 und 80:
Söhnen von Eva Soff seien daher tr
- Seite 81 und 82:
zunächst nach Leitmeritz zu ihrem
- Seite 83 und 84:
Popper gestanden hatte. Dieses Gem
- Seite 85 und 86:
erbringen, dass der inzwischen in d
- Seite 87 und 88:
Die Finanzlandesdirektion für Wien
- Seite 89 und 90:
1 Öl sitzendes Mädchen 1 Öl Land
- Seite 91 und 92:
am 3. Februar 1939 von der „Galer
- Seite 93 und 94:
Spirituosenhändler, der eine groß
- Seite 95 und 96:
von Alt, „Der Stephansplatz“, m
- Seite 97 und 98:
Popper, ehemals wohnhaft, Wien 4.,
- Seite 99 und 100:
genehmigten Kaufvertrag „arisiert
- Seite 101 und 102:
Die Wiener Restitutionskommission s
- Seite 103 und 104:
Notar Dr. Harald Wimmer, Mitglied d
- Seite 105 und 106:
Die noch vorhandenen Möbel würden
- Seite 107 und 108:
I. N. 59.587/ 1, 2 2 Schränke, Bie
- Seite 109 und 110:
Oktober 1900 Else Eissler, geboren
- Seite 111 und 112:
eingerichtet worden wäre, sollte s
- Seite 113 und 114:
Wohnadresse 1938 in Wien lautete Wi
- Seite 115 und 116:
Georg Heinrich Breuer wurde am 2. J
- Seite 117 und 118:
Die Wiener Restitutionskommission w
- Seite 119 und 120:
In ihrem am 15. September 1994 in B
- Seite 121 und 122:
Die Kommission hielt es nicht für
- Seite 123 und 124:
Schätzgebühr für die erblasseris
- Seite 125 und 126:
Restitutionskommission in der Sitzu
- Seite 127 und 128:
Aus dem „First and Final Account
- Seite 129 und 130:
3. 2. 8. Ergänzung zur zusammenfas
- Seite 131 und 132:
Finanzlandesdirektion für Wien vom
- Seite 133 und 134:
Es erscheint daher angebracht, folg
- Seite 135 und 136:
Spitals in Wien entlassen. Blum gel
- Seite 137 und 138:
Schließlich schlug Otto Demus dem
- Seite 139 und 140:
Einem kürzlich im Internet veröff
- Seite 141 und 142:
Nachdem alle Schreiben der Museen d
- Seite 143 und 144:
Verfolgungsmaßnahmen der Nationals
- Seite 145 und 146:
gemacht werden, die Dorothea Minich
- Seite 147 und 148:
Am 12. März 1943 erwarben die Stä
- Seite 149 und 150:
Hinweise auf Adele Graf. Die Anträ
- Seite 151 und 152:
Laut Meldearchiv der MA 8 sind von
- Seite 153 und 154:
Machtergreifung des Nationalsoziali
- Seite 155 und 156:
2067 alte I.N. 2148 2074 alte I.N.
- Seite 157 und 158:
versuchen die Museen der Stadt Wien
- Seite 159 und 160:
Heinestraße 33/17, die von den Nat
- Seite 161 und 162:
ermordet. Ein Todeserklärungs- bzw
- Seite 163 und 164:
I. N. 71.179 Lithografie, Alexander
- Seite 165 und 166:
Die Museen der Stadt Wien haben im
- Seite 167 und 168:
würde das Eheppar Wittner und dami
- Seite 169 und 170:
Eine Untersuchung ergab, dass die S
- Seite 171 und 172:
Unter dem Namen Max Pollak wurde di
- Seite 173 und 174:
Dr. Oskar Reichel besaß eine groß
- Seite 175 und 176:
Universalerbin bestimmt worden war
- Seite 177 und 178:
3. 3. 8. a. Zusammenfassende Darste
- Seite 179 und 180:
dass die in Amsterdam lebende Nicht
- Seite 181 und 182:
3. 3. 8. b. Ergänzung zur zusammen
- Seite 183 und 184:
Dorotheumsankäufe 1938 - 1945 aufz
- Seite 185 und 186:
€ 18.000,-- (Gemälde Kempf von H
- Seite 187 und 188:
Rumäne namens Eduard Thenen, geb.
- Seite 189 und 190:
Anträge betrifft die Büste von Vi
- Seite 191 und 192:
Großneffen von Dr. Josef Thenen, m
- Seite 193 und 194:
Es ist anzunehmen, dass Ella Zirner
- Seite 195 und 196:
Aus der ehemaligen Sammlung Josef I
- Seite 197 und 198:
Aus der ehemaligen Sammlung Ella Zi
- Seite 199 und 200:
im Bereich der Stadt Wien 1998-2001
- Seite 201 und 202:
(Siegmund Glesinger) 51 sowie in de
- Seite 203 und 204:
sogenannten Möbelverwertungsstelle
- Seite 205 und 206:
Von Julius Fargels Widmungen weisen
- Seite 207 und 208:
Dr. Ernst Steiner war am 13. März
- Seite 209 und 210:
Städtischen Sammlungen von Fargel,
- Seite 211 und 212:
I. N. 114.155 Bleistiftzeichnung, E
- Seite 213 und 214:
3. 9. 2. 5. Zusammenfassende Darste
- Seite 215 und 216:
13. April 2006. Der Bericht über D
- Seite 217 und 218:
Ergänzende Darstellung, Oktober 20
- Seite 219 und 220:
Aus den seit dem 25. September 2003
- Seite 221 und 222:
Wie die Kunstgegenstände Otto Jahn
- Seite 223 und 224:
Oktober 1956 hatte sie ihre Nichte
- Seite 225 und 226:
MA 10/977/40 Antiquariat Heinrich H
- Seite 227 und 228:
I. N. 59.899 Wachsbossage für die
- Seite 229 und 230:
Rosalia Chladek (1905-1995) 75 war
- Seite 231 und 232:
Akt, Anträge an den Hilfs- oder Ab
- Seite 233 und 234:
Finanzlandesdirektion Wien, des „
- Seite 235 und 236:
I. N. 74.658 Gemälde, Alexander Cl
- Seite 237 und 238:
Die Suche nach Unterlagen über „
- Seite 239 und 240:
3. 9. 4. 12. Zusammenfassende Darst
- Seite 241 und 242:
68.793 Zeitungsausschnitt, Die Bran
- Seite 243 und 244:
IKG-Wien fand am 27. Oktober 2004 s
- Seite 245 und 246:
für den Beirat des Bundes unter Ei
- Seite 247 und 248:
Für die Provenienzforschung und di
- Seite 249 und 250:
Zahlreich sind auch weiterhin die d
- Seite 251 und 252:
Die Provenienzforschung der Museen
- Seite 253 und 254:
Die Museen der Stadt Wien ersuchten
- Seite 255 und 256:
abgeschlossen ist und bei deren Nic
- Seite 257 und 258:
Provenienzforschung und eine Objekt
- Seite 259 und 260:
3.13. Ausblick Auch im Berichtszeit
- Seite 261 und 262:
Sammlung Dr. Heinrich Rieger, vier
- Seite 263 und 264:
Über 2.300 inventarisierte Objekte