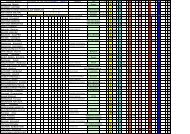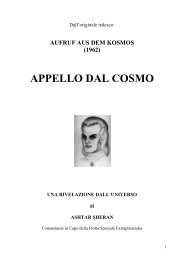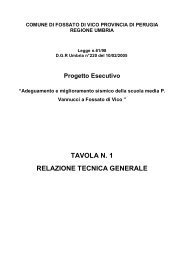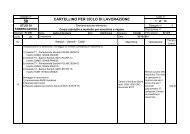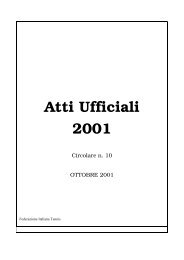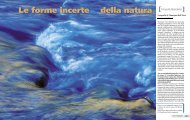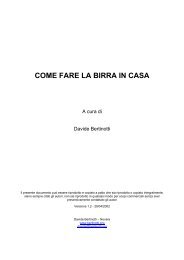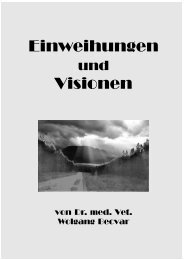-Mereberch = >Merenberg< - © - Manfred Fay – Dillenburg - 1
-Mereberch = >Merenberg< - © - Manfred Fay – Dillenburg - 1
-Mereberch = >Merenberg< - © - Manfred Fay – Dillenburg - 1
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Graven von Dietz hatten noch vor dem Jahr 1337 die Cente Bleseberg als ein Kirchspielgericht<br />
entstehen lassen. Welches dann später an Hand der Beurkundungen seit dem Jahr 1477 als das<br />
Blesseberger Gericht und im Jahr 1488 als Gericht zu Frickhofen im Bleiszbercher Kirspel bezeichnet<br />
wurde. Das Gericht umfasste das so genannte Kirchspiel Blasiusberg bzw. folgende Orte in diesem<br />
Gerichtsbezirk: Frickhofen, Dorchheim, Dorendorf mit dem Burgsitz, Lanyen- bzw. Langen-Dernbach,<br />
Mühlbach, Waldmannshausen mit dem Sitz der Dietzer Walbotten, Wilsenroth und die ausgesiedelten<br />
Orte Gernbach, Ober-Ludenhausen, Aventraude = Aventrode, Valethin oder Valehin und Schelde bzw.<br />
Sleide. Das Wappen des Gerichtes war der Galgen und das Rad, dieses Gericht war mit 7 Schöffen<br />
besetzt.<br />
Diese Gerichtsorte waren im 15. Jahrhundert in „Czechen“ unterteilt, der Vorsteher im Jahr 1429 der<br />
Heimberger aus Frickhofen war. Er teilte die gerichtlichen Verordnungen mit und hob die so genannte<br />
Bede = Ertragsteuer. Noch im Jahr 1285 wurde der Heimberger in Frickhofen als Centuriones<br />
bezeichnet. ( Quelle: Wyß A. I. )<br />
Das Gericht tagte alle 40 Tage auf dem Blasiusberg, angeblich auf dem Friedhof im Freien. Dort sollen<br />
sich dann die Freyen und Hörigen des Gerichtsbezirkes, vor eben diesem Heimberger mit den<br />
angegebenen Schöffen, versammelt haben. Diese Zusammenkünfte wurden, so schildern es<br />
zumindest die Überlieferungen, als Rügentage oder Geschworenen Montage bezeichnet.<br />
Eine erste Kirche in Dorlar = TorLahr oder Doren-Lahr = Dorenlaher = Dorenlager? hat bereits um das<br />
Jahr 750 bestanden. Fundamente von drei Vorgängerkirchen der heute bestehenden Kirche konnten<br />
bei der letzten Renovierung im Chorraum freigelegt werden. Hiervon findet eine romanische<br />
Rechteckkirche 1182 in einer Urkunde Erwähnung. Im Jahre 1218 wurde die damals bestehende<br />
Kirche zusammen mit großen Teilen des Dorfes während einer kriegerischen Auseinandersetzung<br />
zwischen den Herren von >Merenberg< als Lehnsleute des Mainzer Erzbischofs und dem Thüringer<br />
bzw. Nüringer Landgrave zerstört. Der Wiederaufbau nach 1220 fiel in die Zeit des Stilwechsels von<br />
der Romanik zur Gotik. Sehr wahrscheinlich ist das Dorlarer Gotteshaus die erste Kirche, welche in<br />
Deutschland im gotischen Stil erbaut wurde. In einer Urkunde vom 18.05.1297 besiegelt Eberhard von<br />
>Merenberg< die Gründung eines Prämonstratenserinnenklosters St. Marien und den Anbau des heute<br />
noch bestehenden drei Achtel Chores an die Kirche. Am 01. August 1304 konnte das Kloster feierlich<br />
eingeweiht werden. Im Jahr 1437 erfolgte seine Umwandlung in ein Mönchskloster, welches bis zur<br />
Reformation ad 1531 bestand. Im Mai 1532 wurde der gesamte Klosterbesitz an Johann von Buseck<br />
bzw. Buchseck verkauft und in der Folgezeit auf gesiedelt. Einer der letzten drei Mönche wurde der<br />
erste evangelische Pfarrer in Dorlar. Von Mauerresten und Kellergewölben abgesehen ist von der<br />
Klosteranlage nur das ehemalige Klostertor am Lindenplatz durch seinen Einbau in ein Wohnhaus<br />
erhalten geblieben. Die Kirche wurde Patronatskirche, von der zahlreiche Renovierungsdaten<br />
überliefert sind. 1985 - 1987 erfolgte die letzte Renovierung bei der u. a. ein Ringanker um die<br />
Außenmauer der Kirche gezogen wurde. Aus dem 12. Jahrhundert stammt der in der Südostecke des<br />
Langhauses aufgestellte romanische Taufstein. Er ist aus Lungstein gebildet und mit einem<br />
Hufeisenfries und Lisenen versehen. Hinter dem Taufstein ist das aus dem Jahr 1699 stammende,<br />
barocke Sandstein-Epitaph von Pfarrer Friedrich Rotenberger in die Südwand der Kirche eingelassen.<br />
Ein von Putten und Zweigwerk eingerahmtes Medaillon mit einem Flachreliefbildnis des Pfarrers<br />
schmückt seine obere Hälfte. Die Engel halten eine Krone über das Bildnis des Pfarrers. Der gläserne<br />
Teil der Tür des Südport, wurde von Jakobus Klonk aus Oberrosphe gestaltet. ( Buchseck = Seckbuch =<br />
Seckbach )<br />
Gefundenes querbeet:<br />
Der älteste Siedlungsbeleg für Hachborn reicht zurück bis in das Jahr 1151, genannt Hachecebrunnin.<br />
Im Laufe der Jahre hatte sich dieser Dorfname mehrmals gewandelt. Die spätere Geschichte<br />
Hachborns ist bis ins 16. Jahrhundert eng mit der Geschichte des früheren Klosters Hachborn<br />
verknüpft.<br />
Um 1180 waren die Graven Giso und Hartrad von Merenburg - einer Burg am rechten Lahnufer bei<br />
Weilburg - die Grundherren des Dorfes Hachborn. 1186 übergaben sie ihre Güter in Hachborn dem<br />
Kloster Arnstein an der Lahn. Dieser ließ in Hachborn ein Prämonstratenserkloster erbauen. Im Jahr<br />
1252 brannte das Kloster angeblich ab. Durch einen angeblichen Sündenablass von 1 Jahr und 40<br />
Tagen wurde das Kloster aufgrund der Mithilfe von vielen Gläubigern an anderer Stelle wieder<br />
aufgebaut. Anno 1527 wurde das Kloster aufgehoben. Der Klosterbesitz ging auf den Landgraven<br />
über. 1789 wurde das Klostergut aufgeteilt und die neuen Besitzer rissen angeblich die baufälligen<br />
Gebäude ab.<br />
Man muss im Graven Ludwig einen Arnsteiner und in Hartrad seinen Schwager oder Schwiegersohn<br />
„von Merenberg" sehen. Das gibt zwar die Funktion dieser Zeugenschaft nicht her. Die beiden Herren<br />
-<strong>Mereberch</strong> = >Merenberg< - <strong>©</strong> - <strong>Manfred</strong> <strong>Fay</strong> <strong>–</strong> <strong>Dillenburg</strong> - 178 1