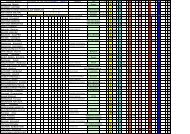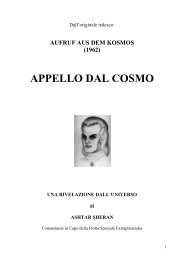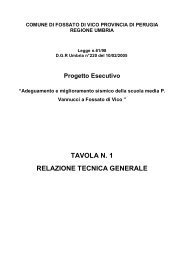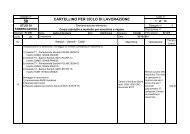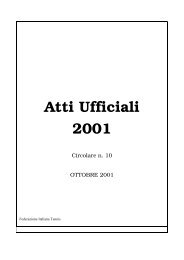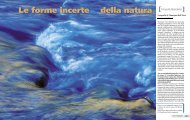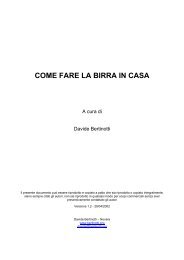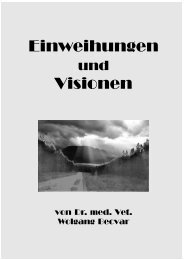-Mereberch = >Merenberg< - © - Manfred Fay – Dillenburg - 1
-Mereberch = >Merenberg< - © - Manfred Fay – Dillenburg - 1
-Mereberch = >Merenberg< - © - Manfred Fay – Dillenburg - 1
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der Ursprung des Geschlechtes der Gisonen ist unbekannt. Diefenbach vermutet, sie wären keine im<br />
Hessengau bzw. Chattengau seit Alters ansässige Macht, sondern vielmehr von außen eingedrungen,<br />
kaum aus der Ulm<strong>–</strong>Gegend, eher aus Niederhessen. Er belegt dies mit dem engen Kontakt der<br />
Graven Giso zu den Graven Werner in Niederhessen, die über Jahrzehnte gemeinsam auf<br />
Dokumenten erscheinen und beide als enge Berater und Gefolgsleute der salischen Kaiser, Heinrich<br />
III.<strong>–</strong> Heinrich V., nachgewiesen sind.<br />
Eine gisonische Graveschaft ist nicht eindeutig gesichert. Es gibt für sie, so lautet die vorherrschende<br />
Meinung, keinen Raum, denn es finden sich keine Orte, die als zur Graveschaft der Gisonen gehörig<br />
bezeichnet werden. Auch graveliche Amtshandlungen sind nicht aktenkundig. Woher kommt aber<br />
dann ihr Graventitel? Die Vermutung liegt nahe, die Gisonen folglich als Amts<strong>–</strong> oder Titulargraven<br />
ohne umfangreiches Familiengut, also ohne allodiale Grapheschaft, einzuordnen. Ihre enge Bindung<br />
an das Königshaus stützen die Ansicht, sie hätten lediglich in Reichsdiensten gestanden. Doch haben<br />
sie nicht unerheblichen Besitz erworben und es verstanden, durch Beseitigung aller Rechte anderer,<br />
auf ihrem Grund und Boden eine gravengleiche Stellung einzunehmen. Die politisch<strong>–</strong> strategische<br />
Bedeutung ihres Herrschaftsbereichs ist schwierig zu beurteilen. Ihr Vogteienbesitz dagegen ist von<br />
großem Wert, verleiht er ihnen doch eine gesellschaftlich herausragende Stellung.<br />
Eine Urkunde König Heinrichs II. an das St. Stephansstift in Mayence aus dem Jahre 1008 gilt als<br />
früheste Erwähnung eines Gisonen. Der Text findet sich in den Monumenta Germaniae Historica<br />
Diplomata, Teil 3, Nr. 178 und lautet: "... , quod nos habuimus in loco Aumena dicto, et quicquid ad<br />
illam curtem pertinet in pago Oberenlangenahe nominato in comitatu Gisonis comitis, per cartam<br />
nostram pro tali commutatione traderemus, ... nos ... susciperemus".<br />
dt.: "... , was uns in der benannten Ortschaft Aumenaw gehört und alles, was sich in der Nähe jenes<br />
Hofes befindet, im Gau namens Oberlahn in der Graveschaft des Graven Giso, haben wir durch unser<br />
Pergament als Austausch für einen Hof in Bickenbach oder Dickenbach ....der Kirche des Heiligen<br />
Stephan zu Mayence anvertraut. Dies bezeugen wir". In den Regesten des Frauenklosters Beselich bei<br />
Schupbach wird deren Landbesitz über Dicken- oder Bickenbach erwähnt.<br />
Die Urkunde ist von Heinrich II. abgezeichnet und von Eberhardus, dem Kanzler und Vertreter des<br />
Erzbischofs Willigis von Mayence verfaßt worden und auf den 18. Mai 1008 datiert. Die Regeste, die<br />
deutsche Kurzinhaltsangabe, bezeichnet das Dokument als Beleg für den Tausch eines Gutes in<br />
Niederolmen mit einem Hof in Bychenbach. Dieffenbach folgerte, dass Grave Giso im Gebiet Nieder-<br />
Olmen, also bei Gemünden, Güter verwaltete oder besaß. Aufgrund der großen Entfernung zu Vetter<br />
und zur Hellande schließt er dann diesen Giso als Stammvater der Gisonen aus. Diese Deutung ist<br />
nicht überzeugend. Die Gisonen sind als Sachwalter des Reiches bis in den Westerwald hinein als<br />
zuständig belegt; sie also in dem Gebiet um Olmen nicht zeitgleich anzunehmen, entbehrt der Logik.<br />
Diefenbach liefert keinen Beweis, warum Aumenaw zwingend zu Nieder<strong>–</strong>Olmen wird.<br />
Im Jahr 1186 gründeten die Graven Hartrad und Giso von >Merenberg< ein Nonnenkloster in Hachberg<br />
oder Hachenburg, welches dem Erzbistum Mayence unterstellt wurde.<br />
Am 29. Oktober 1323 verkauft Giso von Molsberg für 24 Mark alle seine Leute, die in den Herrenhof<br />
Ascebach gehören, mit Ausnahme der Cringin an Hiltwin, „pastorgin“ von Elkerhausen bzw. Helgeroder<br />
Hilgerhausen. Elgershausen wird angeblich erstmals 1123 urkundlich Elgemarshusen genannt.<br />
Kommen die Besitzrechte des St. Stephansstiftes zu Mayence an Gütern in Aumonau erst aus der Zeit<br />
nach 1118? Wilhelm Buchenauer präsentiert in seinem Buch "Warzenbach" ein Mayencer Dokument,<br />
das er in die Zeit vor oder um 1130 datiert. Darin heißt es:<br />
"He sunt uille et uici decimationibus pertinentes ad prebendam fratrum in curtu Edelezdorf: ...<br />
Aumenawa, Vilmar media pars, Hasepho, ..., Ernestehusun, Munechhusun, Warzbach,<br />
Brungotheshusun, Cagerenbach, ...". dt.: "Dies sind die Höfe und Dörfer mit Zehntpflichtigen, zur<br />
Pfründe der Brüder in Ebsdorf gehörend: ... Aumenau und Oberndorf, heute Wüstung ( =<br />
Oberaumenau), halb Villmar, Rasphe, ..., Ernsthausen, Münchhausen, Warzenbach, Cernbach ...".<br />
Es erscheint in keiner Weise abwegig, den genannten Giso als Stammvater der Gisonen anzusehen<br />
und ihn der Burg Hollande, auch zu Beginn des 11. Jahrhunderts, zuzuordnen. Ein weiteres Indiz liefert<br />
der nachgewiesene Reichsgut<strong>–</strong> Charakter des Burgwaldes und des Wollenberges, der seit<br />
karolingischer Zeit als königlicher Reichsforst, später „silva forst", belegt ist und seinerzeit noch<br />
ungeteilt war. Die angesprochene Stifts-Gründung in Wetter mit der Notwendigkeit, diese auch<br />
militärisch zu schützen, liefert ein drittes Argument für die zwingend gebotene Grafen-Präsenz und<br />
führt zu den gisonischen Graven und Vögten.<br />
Vor kurzem wurde mir ein Buch empfohlen mit dem Titel „Die Cochemser“ von Heinz Kochems aus<br />
dem Jahr 1981, hier lesen wir: „Zwei Dinge habe ich gefunden, die mich veranlassten, mich mit der<br />
Geschichte des Westerwaldes eingehender zu befassen.“<br />
Kochems befasst sich in seinem Buch auf Seite 94/95 mit den Gisonen. Er schreibt, dass auf Giso<br />
dessen Gattin unbekannt sei, sein Sohn Giso I. gefolgt sei, der im Jahr 1049 erwähnt wurde. Auf Giso<br />
I. folgte Giso II., der im Jahr 1073 genannt wurde und sich von „Gudensberg oder Gutenberg“ genannt<br />
habe. Er wiederum hatte einen Sohn, er war Giso III., wurde im Jahr 1108 erwähnt, er verstarb im Jahr<br />
-<strong>Mereberch</strong> = >Merenberg< - <strong>©</strong> - <strong>Manfred</strong> <strong>Fay</strong> <strong>–</strong> <strong>Dillenburg</strong> - 73 7