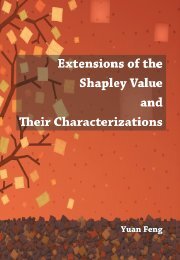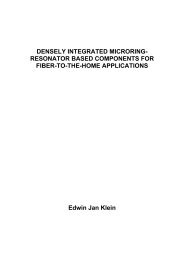WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
WAS TUT GUT? - Universiteit Twente
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. Die Ungewissheit der Zukunftsprognosen schwächt erheblich die<br />
praktisch - politische Anwendung der zugrunde gelegten ethischen<br />
Prinzipien.<br />
„Denn dort (in der Anwendung, mk) soll doch der vorgestellte Endeffekt zur<br />
Entscheidung darüber führen, was jetzt zu tun und zu lassen ist, und man verlangt<br />
schon beträchtliche Sicherheit der Vorhersage, um einen erwünschten und sicheren<br />
Naheffekt wegen eines ohnehin uns nicht mehr treffenden Ferneffekts<br />
aufzugeben.“ 165<br />
Diese Jonassche Überlegung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten<br />
nachhaltig bestätigt. Die Zukunftsprojektionen erscheinen unsicherer denn je und<br />
folglich ist es noch schwieriger geworden, auf ihnen basierende ethische Prinzipien<br />
praktisch durchzusetzen. Die von Jonas geforderte ‚höchsten wissenschaftlichen<br />
Ansprüchen’ genügende Forschung nach den Fernwirkungen’ scheint in diesem<br />
komplexen und zukunftsoffenen Geflecht strukturell nicht in der Lage, die ihr<br />
gestellte Aufgabe ausreichend wahrzunehmen, einfach weil die Entwicklung der<br />
Phänomene nicht in hinreichender Form zu antizipieren ist.<br />
Das „selbsttätige Momentum“ torpediert allzu oft die Bemühungen dieser<br />
Forschungsrichtung und zahlreiche Beispiele belegen, wie technische Neuerungen<br />
eine völlig andere, ursprünglich weder intendierte, noch auch nur ansatzweise<br />
vorhergesehene Verwendung gefunden haben. Weil dieser Punkt für den gesamten<br />
Argumentationsgang der Heuristik der Furcht eine nachhaltige praktische Bedeutung<br />
hat, möchte ich ihn noch etwas vertiefen und drei Beispiele aufgreifen, die als<br />
Illustrationen des Gesagten interessant sind.<br />
Hans Achterhuis erwähnt in seinem Aufsatz über Andrew Feenberg 166<br />
dessen Beispiel einer unerwarteten und von ihren Entwicklern zunächst auch<br />
ausdrücklich abgelehnten Nutzung einer Technologie. Es handelt sich um ein<br />
Anfang der 80er Jahre in Frankreich eingeführtes elektronisches System mit<br />
dem Namen Minitel. Die französische Regierung verteilte damals Millionen von<br />
Terminals an französische Haushalte, die über einen Telefonanschluss<br />
verfügten, um ihren Bürgerinnen Zugang zu zentralen Datenbanken zu<br />
verschaffen. Das System war ursprünglich ausschließlich als Mittel zur<br />
165 Jonas. 1979, S. 68<br />
166 Hans Achterhuis. 2001. S. 80ff.<br />
119